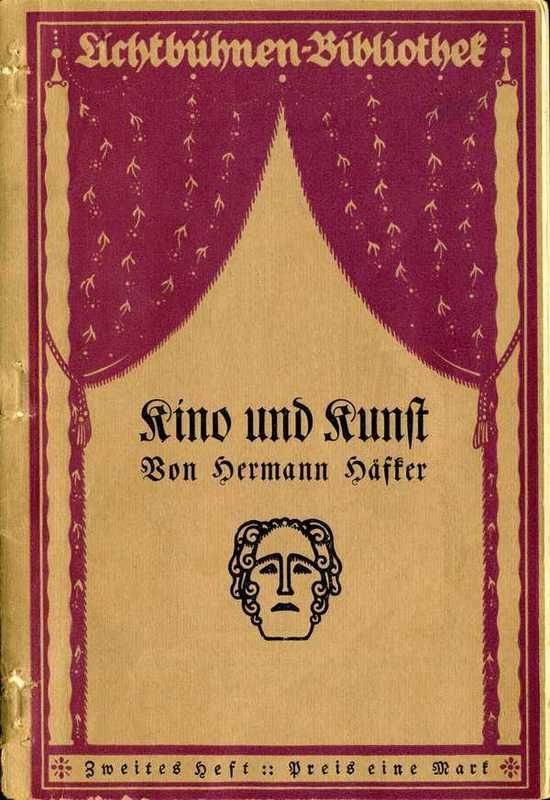
Original-Bucheinband
Lichtbühnen-Bibliothek
Von Hermann Häfker
Zweites Heft :: Preis eine Mark
Kino und Kunst
von Hermann Häfker
Lichtbühnen-Bibliothek Nr. 2
Herausgegeben von der Lichtbilderei
Volksvereins-Verlag GmbH., M.Gladbach 1913
| A. | Allgemeines: | ||
| 1. | Der Ruf nach Kunst | 5 | |
| 2. | Das Wesen der Kinematographie | 11 | |
| 3. | Die künstlerische Aufgabe | 16 | |
| B. | Die Herstellung des Films: | ||
| 1. | Die künstlerischen Gesichtspunkte in der technischen Filmherstellung | 19 | |
| 2. | Technische, industrielle usw. Lehr- und Verdeutlichungsaufnahmen | 24 | |
| 3. | Geschichtliche und kulturgeschichtliche Aufnahmen, Bildnisse | 27 | |
| 4. | Die Schönheit der natürlichen Bewegung | 32 | |
| 5. | Gestellte Bilder | 41 | |
| Die Schönheit der menschlichen Bewegung (Tanz, Gebärde) | |||
| Kino und Humor | |||
| Das Drama | |||
| C. | Die Vorführung: | ||
| 1. | Kinematographie oder Kinetographie | 49 | |
| 2. | Das „Programm“ | 55 | |
| 3. | Einzelheiten | 62 | |
| 4. | Wege | 70 | |
Die gewaltige Bewegung, der von viel tausend Stimmen aufgenommene Ruf nach „ästhetischer Kultur“, nach „Kunst überall“ ist hervorgegangen aus der eigentümlichen Not einer Zeit, die anders ist als eine je vordem dagewesene. Ehedem thronten in ihren Tempeln erhabener Würde die Künste: Musik, Malerei, Bildhauerei, Dichtkunst, Baukunst. Der Widerschein der Schönheiten, die sie schufen, fiel spärlich und milden Glanzes auf das ganze Alltagsleben, seine Gebrauchsgegenstände und seine geistigen Äußerungen. Gelehrte stritten sich um höchste Schönheit und echten Stil, Kirchen, Fürsten und Reiche führten den „Geschmack“. Wo Kunst war, war eine große Idee, großes Wollen, großes Können, Lebensverdichtung. Aus den Werken der Kunst strömten große Empfindungen, stark bewegend und doch fern von allen Alltagsleidenschaften in den Beschauer über. Der Anblick von Kunst war ein Fest, weil er selten wie ein Festtag war.
Heute ist diese Zeit auf Niewiedergewinn verloren. Bildmäßiges und Plastisches, Wort und Klang, Farben und Linien, früher die Wahrzeichen jener Festtagskunst, strömen wie Hagelwetter auf die Nerven des modernen Menschen — besonders, aber nicht allein, in der Großstadt — ein. Beim Aufstehen begrüßt ihn neben dem Frühstück ein dickes neues Buch: die „Zeitung“. Lauter zu uns gesprochene Worte, geistige Beeinflussung mannigfacher und auf Nervenaufpeitschung berechneter Ordnung, die sich durchaus der Mittel der Literatur bedient. Aus unserm Hausrat, bis hin zu unserer Tapete spricht die malerische und plastische Phantasie vieler Menschen, ja vieler und großer Zeiten zu uns. Ein Gang durch die Straße führt uns an Ankündigungssäulen, Wandflächen voller Bilder und lauten Reden vorbei. Die Ladenfenster entfalten alle Kräfte der Seelengewinnung, die ihre Hersteller den raffiniertesten Erzeugnissen der Künste abgesehen haben. Die Buchläden locken und reden mit tausend Zungen auf uns ein. Im Café warten unserer — und selbst in der volkstümlichen Lesehalle — Hunderte von glänzend „illustrierten“ Zeitschriften und Zeitungen.[Pg 6] Musikkapellen spielen dazu. Abends verwandelt sich die Großstadtstraße in ein Feuerwerk, dessen jähe und blendende Pracht unsere Sinne und Gedanken lange abzieht und im Banne hält. Man darf sagen: Wer überhaupt für diese Dinge noch Sinne hat (dem in der Großstadt gesund Aufgewachsenen wächst in der Tat, wie mir scheint, bald eine Art Schutzhaut, aber die reifend von draußen hereinkommen, sind die Opfer) — ich sage: Wer diese Dinge ernst nimmt, naiv zu verarbeiten sucht als das, als was sie sich doch durchaus geben, als Künste — der braucht kostbare Entwicklungsjahre, um sich überhaupt hindurch zu finden. Um hindurchzukommen, vom ersten Begeisterungsrausch durch erwachende innere Gegenwehr bis zur nötigen Abgebrühtheit. Denn alles, was hier mit den Mitteln der Künste arbeitet, erzeugt nicht reine, sondern Fuselrauschstimmung, wenn es nicht hohen und reinen Dingen dient, aus hohem und reinem Geiste hervorgegangen ist. Es ist nicht nur die ständige Aufpeitschung der Sinne, die an all dem liegt, durch kitzelnde Genüsse — es ist alles auch „Ausdruck“. „Ausdruck“ von einer Wirklichkeitswelt und einer Gesinnung, die dahinter liegt.
Die Gesinnung, die sich durch dies alles ausdrücken will, die Ideen, die dies alles suggerieren will, sind nicht selten, nicht menschlich hoch und echt. Vom einfachen Anpreisen und Einredenwollen mehr oder weniger zweifelhafter Bedürfnisse bis zum zwecklosen Spiel mit Ausdrucksformen vergangener Zeiten, ist dies alles gemeine Alltäglichkeit. Gemeine Alltäglichkeit in aufregende festliche Gebärden gekleidet. Massenhaft — nicht selten und echt — ist schon die Erfindung, die dem meisten dieser Art zugrunde liegt. Das ist das eine Eigentümliche. Und diese Massenerfindung wird nun — das ist das zweite — mit einem geringsten von Menschenmühe, automatisch-chemisch-maschinell vervielfältigt. Nicht, wie die Platte des Holzschneiders, langsam und mühevoll einige hundert Male — sondern Tausende und Hunderttausende von Malen, mühelos, schnell und billig. So kommt es, daß ein einziger Einfall, etwas Gemeines mit künstlerischem Mittel (bildlich, musikalisch, dichterisch) „auszudrücken“, morgen nicht eine Verkehrsecke in einer Stadt schändet, sondern von den Wänden, Läden, Schaufenstern und Lichtgerüsten aller Städte und vieler Dörfer — nicht Deutschlands, sondern ganz Europas, oft der ganzen Welt — herunterschreit. Und jeder Tag bringt Neues. Noch nie, solange es eine Geschichte gibt, hat jeder einzelne Mensch, er mag wollen oder nicht, so viele eindringliche, mit den wirkungsvollen und oft gewandt gehandhabten Mitteln der Künste hämmernde Eindrücke auf Sinne, Herz und Denken aushalten müssen, wie der, der heute mittags aus Bureau und Geschäft tausend Schritte bis zu seiner Mahlzeit geht.
Lange Zeit war der Buchstabendruck die einzige herrschende Form, Kunstähnliches — in Worte geprägte Gedanken — in Massen zu verbreiten und zwangsweise, unausweichlich, dem Menschen aufzudrängen. Die literarischen Künste waren die einzigen, die darunter leiden mußten. Wer Musik oder ein gutes Drama hören wollte, wen’s nach Bildern oder plastischen Werken gelüstete, der mußte sich noch extra rüsten, mußte Konzerte oder Theatersaal, Ausstellung oder Museum aufsuchen.
Da kamen neue Erfindungen herzu, die auch alle andern Künste wehrlos machten. Von denen, die billige Vervielfältigung architektonischer und neuerdings plastischer Werke ermöglichten, schweige ich hier. Aber man kam jetzt auf den Weg, diejenigen Sinneseindrücke, die durch „Wellen“ physikalischer Natur erzeugt werden, dadurch festzuhalten und zu vertausendfachen, daß man diese Wellen — die optischen und die akustischen — sich selbst in festem Stoffe fangen und „aufschreiben“ ließ. Von dieser so gewonnenen „Naturmatrize“ konnte man nun so viel „Abdrücke“ nehmen, wie man wollte. Der Stoff zum Auffangen optischer (Gesichts-) Eindrücke (Lichtwellen) war die photographische Schicht, der zum Auffangen phonetischer (Gehörs-) Eindrücke (Klangwellen), war die — verschieden zusammengesetzte — Walze oder Platte der Phonographen und die Schablonen automatischer Musikinstrumente. Phonograph (Grammophon, Pianola) und Photographie waren die neu gewonnenen Techniken. Von ihnen hat zuerst die Photographie mit ihrer immer größern Vervollkommnung einen Siegeszug durch die ganze Welt genommen. Infolge ihres bescheidenen und gewissenhaften, hingebenden Automatismus wurde sie zu einer wertvollen Helferin ästhetischer Kultur durch massenhafte Verbreitung künstlerischer Einzelvorlagen und eine selbständige Deuterin und Weiserin der Natur durch fälschungslose Wiedergabe gewisser Seiten von ihr. Sie ist es, die — vielen noch unbewußt — uns auch aus den meisten bildlichen Eindrücken der Straße und des öffentlichen Lebens anspricht, die scheinbar Werke ursprünglicher Handkunst sind.
In ihrer einfachen Gestalt als Augenblicksaufnahme hat die Photographie gewiß mehr Segen als Unheil gestiftet. Dann aber arbeitete der Erfindungssinn einen Weg zu ihrer Anwendung aus, durch den sie plötzlich eine unheimliche und verheerende Macht über menschliche Gemüter und menschliche Kultur gewann. Sie wurde zur Kinematographie. An sich nichts als eine planmäßige, durch einen wunderbaren Mechanismus ermöglichte Vorführung tausender von Augenblicksaufnahmen nacheinander, ahmte doch diese Photographie nicht nur Licht und Schatten eines toten Bildes nach, sondern selbst Plastik und Bewegung lebendiger Wirklichkeit. So[Pg 8] trat sie mit einemmal als Nebenbuhlerin nicht nur der Malerei, sondern selbst des Schauspiels, in einem gewissen Grade selbst der Plastik, und in Verbindung mit der Grammophonie selbst der Oper und der Vortragskunst auf. Mit den verdichteten Reizen dieser seelenaufrüttelnden Künste verband sie etwas von der trockenen Stilisierung des Puppentheaters und fügte hinzu die — äußerste Wohlfeilheit sensationeller Jahrmarktsgenüsse.
Sie fügte den automatisch erzeugten und vervielfältigten kunstähnlichen Eindrücken, die sich dem Straßenmenschen heute aufdrängen, ihn zauberhaft locken, vielleicht den mächtigsten hinzu. Auch um deswegen den mächtigsten, weil sie schon von allen am kunstähnlichsten ist, will sagen, ihre Gebärden von einer ganzen Reihe und von den an sich schon eindrucksvollsten Künsten borgt. Sie hat dadurch wirklich Theatern „Konkurrenz“ gemacht, das beweist doch: sie hat Zuschauer an sich gezogen, die „Kunst“ gesucht haben, und denen die Kunst der Schaubühne mindestens zu umständlich zugänglich und — zu teuer war. Die Eindrücke, die sie bot, waren allerdings jetzt fast ausnahmslos das Gegenteil künstlerischer: sie waren nicht „rein“, sondern beruhten auf einem Aufschäumen solcher Instinkte, deren gemeinste auch die Hunde am Prellstein erregen: Geschlechtsgefühle, Angst, Gier, Eitelkeit, erkitzeltes Gelächter, fuselhafte, anstrengungs- und maßlose, begeisterungsüßliche Rührsamkeit. Und das „Große“, das durch sie zu den Besuchern sprechen wollte, denen diese Kunst „Ausdruck“ wurde, war nur oder fast nur das großgeschriebene „Verdienen“!
Unter dieser Sintflut von „Ausdrucks“-Techniken, die die Welt seit wenigen Jahrzehnten — auf Niewiedervergehen — überschwemmten, bäumte sich, nach anfänglichem Versagen, die gesunde Widerstandskraft des menschlichen Geistes auf. Große Bewegungen strebten, unter verschiedenen Namen, in diese neue Welt von Geisteseinwirkungen das hineinzubringen, was ihr fehlte: Gewissenhaftigkeit. Aber mit „moralischen“ Schlagworten wäre man hier nicht weit gekommen.
Denn wer um Moral prozessiert, hat die Last des Beweises zu tragen. Wer aber jemandem nachweisen will, daß er irgendetwas getan oder geschaffen habe aus „unmoralischer“ Gesinnung, der müßte in den Herzen lesen können. Die Behauptung, moralisch in gutem Glauben gewesen zu sein, ist schwer zu widerlegen. Es kann auch eine Tat oder ein Werk als Leistung durchaus moralisch sein, das in der Wirkung, wenigstens auf einen Teil der Beeinflußten, unmoralisch ist. Wer einen Mann oder ein Werk als „unmoralisch“ verklagt, muß den objektiven Beweis der Unmoral führen: Moral aber ist zumeist Gesinnungssache.
Unter den kinematographierten „Dramen“ befinden sich viele,[Pg 9] die von „Moral“ nur so triefen, und die doch das Verwerflichste und Verbildendste sind, das erdacht werden kann. Anderseits haben nicht nur „Schund“-Werke, sondern es haben auch Goethes „Werther“ Selbstmorde, Schillers „Räuber“ Totschläge angeregt. Von einem Schaffenden „Moral“ fordern, heißt seine Gewissenhaftigkeit ansprechen — sie nachzumessen gibt es keinen menschlichen Maßstab. Die moralische Forderung ist kein Schutz gegen das Verderbliche in Literatur, Kunst und denjenigen Tätigkeiten, die sich künstlerischer oder kunstähnlicher Mittel bedienen.
Die künstlerische Forderung aber wendet sich nicht an den Schaffenden — dem kann sie nach getaner Arbeit oder bei mangelnder persönlicher Veranlagung nichts nützen — sondern sie wendet sich an den Empfangenden. Sie öffnet ihm Sinne und Bewußtsein, um das Echte, das im ungeweihten Ohr von jedem Lärm übertönt wird, zu vernehmen, sie gibt ihm Schutz, Gegengift und das Mittel zu bewußter Ablehnung des aus fauler Quelle Geflossenen. Die „künstlerische“ Forderung umschließt die moralische: weil das künstlerische Sehen etwas erschauen läßt, das Widerstandskraft und einen Widerwillen gegen jede Sinnenreizung niedrigerer, „unmoralischer“ Natur erzeugt. Was wir als schmutzig und gemein erkennen, ist niemals Kunst,— nicht weil es schmutzig und gemein ist, sondern weil es andere Nerven in Mitschwingung versetzt als die, durch die wir das Künstlerische erkennen. Wohl können auch künstlerische und gemeine, schmutzige Bestandteile in einem Werke vereint sein, aber eben sie sofort zu unterscheiden, die einen anzunehmen, gegen die andern immun zu bleiben, das ist wesentlicher Segen der „ästhetischen Kultur“, d. i. „Sinnenschulung“.
Diese Einsicht hat gewiß sehr dazu beigetragen, die von verdienstvollen Stellen gepredigte „Ausdruckskultur“ so allgemein angenommen werden zu lassen, aber es wäre ein Irrtum, sie nur um dieser, ihrer „moralischen“ Wirkung willen, fordern und pflegen zu helfen. Man kann ebensogut den künstlerischen Charakter eines Erzeugnisses darin erblicken, daß es die Gesundheit des Genießens wie des Schaffens, oder daß es den wirtschaftlichsten Kraftverbrauch auf beiden Seiten im stofflichen wie im geistigen Sinne verbürgt. Beides sind Werte, deren sich der einzelne wie die Gemeinsamkeit praktisch nur dadurch vergewissern kann, daß sie all ihr Tun wie ihr Genießen zur Kunst erheben. Suchen wir aber die Bedeutung der künstlerischen Forderung und ihre innere Kraft ganz allgemein gerade für die unserer Zeit eigentümliche Not zu erfassen, so kommen wir immer wieder darauf, daß sie auf eine Eindämmung des Vielzuvielen, auf die Wiederunterwerfung der herbeigerufenen Maschinen- und Automaten-Massenproduktionsgeister unter den wollenden menschlichen Geist[Pg 10] hinausläuft. An die Stelle der Herrschaft mechanischer Bequemlichkeiten und automatisch-stofflicher Sinnenreizungen setzt sie wieder den wählenden und ablehnenden Menschen, an die Stelle passiven Leben-über-sich-ergehen-Lassens setzt sie das Tun, das Schaffen, das Eigen- und Selbstsein, die Bejahung und Erhöhung des Lebendigen in uns. Sie setzt uns selber an die Stelle unserer Lebensverzierungen und Nervenkitzelmaschinen.
In diesem Sinne ist’s, daß angesichts der besondern Not der Zeit die alte Forderung wieder allgemein wurde, ja erst eigentlich feste Gestalt und tiefere Begründung erhalten hat, daß wir alles, was wir tun, als Kunst tun sollen. Eine Sache künstlerisch machen, heißt aber, nach Schiller, in letzter Linie nichts anderes, als sie „vollkommen“ machen: sie so innerhalb der durch ihre stoffliche und technische Eigenart, ihrer wirtschaftlichen und Zweckbedingungen gesteckten Grenzen bis zum Rande mit eigengefühltem Leben anfüllen, daß das Ergebnis in jedem einzelnen Falle das höchsterreichbare ist.
Die Kinematographie zur Kunst erheben, sie als Kunst ausüben, läuft also darauf hinaus, sich zunächst einmal so ehrlich und unvoreingenommen wie möglich in ihr Wesen und ihre Bedingungen zu vertiefen, sich ihrer Grenzen wie ihrer Aufgaben und Möglichkeiten bewußt zu werden. Zu zweit ist dann die Aufgabe, diese gegebenen Möglichkeiten innerhalb des Gebots des Echtbleibens so mit Leben zu erfüllen, daß das fertige Lichtschauspiel, wie irgendeine andere Kunst, der lebendigste „Ausdruck“ eines hinter ihm stehenden menschlichen Wollens, menschlichen Empfindens, Freuens und Leidens wird. Von diesem Drange nach Fülle erfüllt, wird auch der Kinokünstler von selber seine Arbeit nicht Wertlosem oder Alltäglichem widmen, sondern das Beste und Gehaltvollste hineinlegen wollen, das der Tag dem Tage geben mag.
Stellen wir uns das Kinoschauspiel so von Seichtheit, Schmutz, Geschmacklosigkeit, gehaltlosem Sinnenkitzel, vor allem von aller Kräfteverschwendung und -verzappelung, von allem Zuviel gereinigt vor, und erinnern uns dann an die geschäftliche Organisation auf der es beruht, und an die es gebunden ist, so muß uns das Herz höherschlagen. Dann würde allwöchentlich in aller weiten Welt aus tausend weiten Stätten heitern, jedermann zugänglichen Genusses eine Fülle reiner stärkender Geistesnahrung in alle Volksschichten hineindringen, würden Volksschichten und Völker der Erde in einem gewissen Grade in gleichen Empfindungen, Gedanken und Anschauungen, in gleichem Wissen und ausgleichender Bildung zu einer Kulturmenschheit zusammengewöhnt werden können. Das Kinoschauspiel vermöchte da mehr als das gedruckte Wort, weil es seinen wirtschaftlichen[Pg 11] Bedingungen nach — im Gegensatz zum Wort — an eine sehr beschränkte und sehr zentralisierte Erzeugung und an einige nur wenig zu vermehrende, großartige Verbreitungsorganisationen gebunden ist. Und weil es, wie schon bemerkt, vermöge seiner unmittelbaren Anschaulichkeit, seiner sinnenpackenden Lebensähnlichkeit und seiner Voraussetzungslosigkeit seltener, aber unvergeßlicher auf den Menschen, besonders den weniger vorgebildeten wirkt.
Wir sprachen vom „Kinoschauspiel“, von dem wir hohe Wirkungen erwarteten. Da werden wir von vielen mißverstanden worden sein. Im gewöhnten Wortsinn versteht man unter einem „Kino-Schauspiel“ das, woran die meisten unter „Kinematographie“ überhaupt zuerst und fast ausschließlich denken: nämlich nicht das „Schauspiel“ besonderer Art, das durch die kinematographische Bildervorführung und ihr Zubehör — Vortrag, Musik usw. — im Kinotheater auf der Leinwand zustande kommt, sondern ein der Bühnendichtung nachgeahmtes „Schauspiel“ — eine Posse oder ein „Drama“ usw. —, dessen optische Erscheinung zum Teil (ohne die Farben u. a.) vom Kinematographen aufgenommen, vervielfältigt und zu einem Bilde verflacht wiedergegeben wird. Ein wenig Nachdenken zeigt uns, daß diese Art von Kinoschauspiel in unsere Auseinandersetzungen nur zum Teil und in einem besondern Sinne gehört. Wir wollen im wesentlichen überlegen, wie wir die Kinematographie selbst zur Kunst erheben können, und nur nebenbei fragen, in welchem Verhältnis sie (als Dienende und Vermittelnde, als Aufbewahrerin und Vervielfältigerin) zu andern Künsten steht. Zum Kinodrama (wie wir’s mal nennen wollen) steht die Kinematographie in zweierlei ganz verschiedenem Verhältnis. Entweder sie will nur dazu dienen, dramatische Darstellungen, schauspielerische Leistungen von besonderm Erinnerungswert der Nachwelt aufzubewahren: sie soll besondere Regieleistungen, Glanzszenen berühmter Schauspieler, Bühnenvorschriften usw. für Archive zu fachlichen oder kultur- und kunstgeschichtlichen Zwecken festhalten. Dann kann sie selber „künstlerisch“ nur sein durch eine besonders vollkommene Erfüllung ihrer technischen Aufgabe, das Gewünschte dokumentarisch getreu, automatisch widerzuspiegeln. Sie kann zu künstlerischem Werte steigen dadurch, daß sie hinter das dramatische Kunstwerk völlig zurücktritt. Niemals aber würde man die betreffende schauspielerische, dichterische Leistung selber „kinematographische Kunst“ nennen. Oder es kann ein Schauspiel erdacht, eine Szene gespielt werden nur zu dem Zwecke, in der kinematographischen Wiedergabe zu wirken: zu dieser Art gehört oder[Pg 12] sollte gehören das meiste, was in Kinotheatern an „Dramen“ usw. gezeigt wird. Hier ist weder das Spiel selber noch die kinematographische Aufnahme das „Kunstwerk“, sondern das Kunstwerk ist erst die Verschmelzung von beiden, das fertige Bild auf der Projektionsleinwand. Man kann hier eigentlich weder von einem „Schauspiel“ (im gewohnten Sinne) wenigstens nicht von einem „Drama“ sprechen noch von „zur Kunst erhobener Kinematographie“, sondern man müßte einen ganz neuen Namen suchen, wie es denn ja auch geschehen ist: kinematographische Bilderspiele, Kino-Schattenspiele, lebende Bilder, Licht-Pantomimen o. dgl. In der Hauptsache unterliegen solche Spiele dem Gesetzgebiet der Dramaturgie, die ja angibt, wie ein Schauspiel aufgebaut, ein Spiel beschaffen sein muß, je nachdem es etwa auf einer modernen Bühne, einem antiken Theater, in einem Zirkus oder einem Puppentheater usw., kurz unter bestimmten Zweckgesichtspunkten zur Geltung kommen soll. Mit diesen Fragen wird sich ja ein anderes Bändchen dieser Sammlung ausführlich befassen. Wir werden an seiner Stelle nur insoweit darauf zurückkommen, wie wir es von unserm Gesichtspunkt — „Kinematographie selbst zur Kunst erhoben“ — zu streifen haben. Das allerwichtigste aber ist für unsere Freunde, sich dies scharf vor Augen zu halten: daß just die Wiedergabe oder auch Schaffung (in gewissem Sinne) von bühnenähnlichen „Stücken“ wie überhaupt die Wiedergabe von „gestellten“ Bewegungsvorgängen weder die einzige, noch die wichtigste Aufgabe der Kinematographie ist, und daß am allerwenigsten gerade da das Gebiet ihres „Künstlerischwerdens“ liegt. Die Wiedergabe von dramatischen „Sujets“, sei’s für Archive, sei’s für Belustigungszwecke ist vielmehr nur eine (wenn auch ausdehnungsfähige und zurzeit besonders begehrte) Betätigung ihrer Wesensaufgabe (in der allein sie auch ihr Emporsteigen zu einer Kunst suchen kann): der durch Menschenhand und -nerv möglichst wenig gefälschten, möglichst wirklichkeitsgetreuen Wiedergabe von natürlichen Bewegungen, auf Grund ihrer chemisch-automatischen Selbstaufzeichnung.
Denn wenn wir uns fragen: was in aller Welt ist denn nun wohl dasjenige an der Kinematographie, worin ihre Eigenart besteht, worin sie sich also von allem andern verwandten — Malerei und Zeichnung, Bühne und Puppentheater, Augenblicksphotographie und Lichtbild, Beschreibung und allgemeine Stimmungserregung, Schattenspiele und Kaleidoskop, und was man sonst alles zum Vergleich heranziehen könnte — unterscheidet, das, was ihr keine andere Kunst oder Technik nachmacht, das, was ihr unsere Herzen gewonnen hat, woran die Kulturmenschheit ihre stolzesten Empfindungen und ihre höchsten Hoffnungen geknüpft hat — so wird doch keiner zur Antwort geben: dies Höchste und Eigenartige ist das „Theaterstück“. Jede Bühne, jedes [Pg 13] Puppen-, ja Kasperltheater hat (sobald man vom künstlerischen Standpunkt daran tritt) unendlich viel vorm Kinodrama voraus. Die Pantomime muß sich auf sehr wenige Wirkungsmittel beschränken, um kinematographisch feststellbar zu sein, und von dem wenigen kommt im fertigen Bilde wieder nur ein Bruchteil zur Geltung. Wir werden ja darüber noch ausführlicher sprechen. Auf jeden Fall brauchte nicht der Kinematograph erfunden zu werden, um Theaterkunstwerke oder auch nur ihre Vorführung in weitern Kreisen zu ermöglichen; und soweit er das letztere tut, tut er’s in denkbar unvollkommenster Weise.
Nein, das vorerst unübertreffliche Neue und Eigene der Kinematographie ist dies, daß sie — innerhalb der ihr gesteckten Grenzen — das Schwarzweiß-Bild wirklicher Vorgänge (nicht nur Augenblickszustände) mit dokumentarischer Treue festhält, vervielfältigt und wieder sichtbar macht. Wer die Kinematographie zur Kunst erheben, ein kinematographischer Künstler sein will, kann es nur werden, indem er diesem Ziele mit immer steigender Vollkommenheit durch Ausnutzung aller in der Technik liegenden Möglichkeiten und ihre weitere Steigerung nachstrebt. Das ist die neue Welt, die sich uns geöffnet hat, seit die Kinematographie Wirklichkeit geworden ist. Vor 30 Jahren las ich eine Novelle von einem Manne, der eine Muschel erfunden hatte, die die im Äther umherirrenden Lichter und Klangwellen längst vergangener Ereignisse auffing und wieder ordnete, so daß ihr Besitzer Cäsar wandeln sah und Beethoven spielen hörte. Es war nur eine Illusion, die Verzückung eines Wahnsinnigen gewesen. Künftige Zeiten werden vermittels der Kinematographie und ihrer grammophonischen Schwester Cäsaren und Beethoven von heute wieder erstehen lassen können, und wir können’s bereits. Meere, die an meilenfernen Küsten wogten, sehen wir wiederwogen, Raum und Zeit vergessend. Aber, das eben ist das Wertvolle der Kinematographie: wir sehen sie nicht wogen, wie die Phantasie des Malers oder die des Theater-Miedings sie sich und uns vorstellt, sondern so, wie sie es wirklich zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Orte taten. Sie haben sich selber gemalt, keine Menschenhand hat zitternde Striche hinzugefügt, dies Bild hat Beweiskraft.
Das kann der Maler nicht, noch irgendein anderer Künstler. Der Wert menschlicher Hand- und Körperkunstwerke beruht auf ihrer Vereinfachung der wirklichen oder gedachten Naturmodelle zu „Motiven“. Ist der Maler „Naturalist“ oder „Impressionist“, will er also von den Sinnen Wahrgenommenes, recht „wirklich“ wiedergeben, so tut er es indem er von den einzelnen körperlichen Erscheinungen, die den festzuhaltenden Sinneneindruck ausmachten, „Abbildungen“ im möglichst naturentsprechenden Mengenverhältnis nebeneinandersetzt. Wie dem [Pg 14] richtigen Dramatiker immer noch ein Baum „Wald“, dem Zeichner einiges blätterähnliche Gekritzel einen „Baum“ „bedeutet“ — so ist dies „Mit-Bedeutungen-Spielen“ doch zuletzt das Handwerkszeug aller Handkünste. Der Maler, der nachahmen wollte, was die Kinematographie kann, nämlich „alles“ wenn auch nur in einem Ausdrucksmittel, dem „Schwarz-Weiß“, wiederzugeben — der wäre kein Künstler; er wäre vielleicht ein Narr. Das kann nur die Natur selbst, — sich selber nachahmen, ein erstarrtes Spiegelbild von sich machen. Umgekehrt: im Auswählenwollen, im Betonen bestimmter Empfindungserreger, im „Komponieren“ und „Stellen“ von Bildern, da ist der Kinematographie wie der Photographie überhaupt ein sehr enges Feld gesteckt. Da liegt ihre Stärke nicht: und dann kann sie sich da auch nicht oder nur in enger Grenze als Kunst bewähren. Die Wesensaufgabe der Kinematographie ist nicht nur, „Wirklichkeit“ wiederzugeben, sondern vor allem auch die Wirklichkeit, die eben keine andere Technik oder Kunst wiedergeben kann: die der freien, unbefangenen Bewegung in der Natur und all ihrem Reichtum an Einzelheiten.
Bevor wir den Reizen und Möglichkeiten dieser Aufgabe nachgehen, müssen wir das Wesen „der Kinematographie“ weiter betrachten. Es wird Zeit, uns nun zu fragen: was ist nun die „Kinematographie“ — was ist das Enderzeugnis, der „Gegenstand“ unseres Kunstbestrebens?
Vor dieser Betrachtung geht’s uns wie vor einem blühenden Baume, dessen Schönheit uns fesselte. Treten wir näher heran, so sehen wir seine lichtgraue Wolke sich in eine wimmelnde Menge von Blüten, Blättern und Zweigen auflösen, von denen jedes einzelne so schön, so vollkommen und in sich abgeschlossen ist, wie uns vorher das Ganze erschien. Auch „die Kinematographie“ besteht ja aus einer reichen Reihe einzelner Betätigungen menschlichen Könnens, einzelner, von Menschen angeregter mehr oder minder automatischer Vorgänge. Jede einzelne dieser menschlichen Betätigungen, Anregungen und Überwachungen chemischer Vorgänge ist, vollkommen ausgeübt, in ihrer Art eine Kunst. Und in fast jeder einzelnen betätigen sich ja meist auch eine oder mehrere andere Personen.
Da haben wir zuerst die kinematographischen Handarbeiten: das Aufnehmen, das Festhalten, das Vervielfältigen und das Wiedergeben des Bildes. Zum Aufnehmen gehört: die Vorüberlegung und Wahl des Bildes, die Einstellung und Bewegung des Films im richtigen Augenblick, die gleichmäßige Bewegung der Kurbel im richtigen Zeitmaß, nachdem der Film richtig eingefügt und die Blende gewählt ist, die gleichzeitige Beobachtung der Vorgänge (die der Film festhält), das richtige Verstehen, auch Studium des Gegenstandes, seine Feststellung, die Bezeichnung und Ordnung,[Pg 15] der Schutz und die Versendung der — vom rohen Film in nichts zu unterscheidenden — Negative. Das Festhalten des Bildes ist, bei allem Automatismus des Grundvorgangs, doch ebenfalls in hohem Grade vom Verständnis und der Aufmerksamkeit des Menschen abhängig: das Entwickeln bis zum richtig getönten, nicht zu scharfen, noch weniger unscharfen Negativbilde, das Fixieren, das Trocknen. Die Vervielfältigung, das ein- oder hundertmalige Kopieren „macht“ zwar eine Maschine, aber „besorgen“ muß es doch der Mensch, der durch Regelung der Belichtung Schwächen des Negativs ausgleicht usw. Das Wiedergeben endlich eröffnet eine verwirrende Fülle von Möglichkeiten: die rein technische Führung des Films hinterm Objektiv vorbei, die Wahl und Ausstattung der Bildfläche, die Unterstützung der Bildwirkung durch das gesprochene Wort, begleitende oder umrahmende Musik, Nachahmung von Naturgeräuschen, Vereinigung mit Lichtbildern und anderm einschließlich beleuchteter Pausen zu einem harmonischen Ganzen (Programmgestaltung) eben der „Vorstellung“, endlich die Raumausstattung.
In etwas weiterm Sinne, und doch nicht unbeteiligt zuletzt auch am künstlerischen Werte des Endergebnisses ist sogar der riesige geschäftliche Apparat, der von zentraler Stelle aus das Programm des kleinsten Vorstadttheaters regeln hilft. Das aber führt uns von den beeinflußbaren, von dem ein Kunstwerk wollenden Menschenwillen eingeschlossenen, zu denjenigen elementaren Bedingungen hinüber, die — wie die finanzielle und soziale Lage der Theaterbesitzer und ihres Publikums — einfach gegeben sind — ohne deren Berücksichtigung aber gleichfalls ein Kinoschauspiel etwas Unvollkommenes und daher auch Unkünstlerisches sein würde.
All diese beeinflußbaren und unbeeinflußbaren Einzelheiten aber haben alle nur (in unserm Sinne gedacht) ein Ziel, wenigstens ein allen andern vorangehendes Ziel: die künstlerisch vollkommene Gesamt-Kinovorführung, das, was ich eingangs das zur Kunst erhobene Kinoschauspiel nannte. Dieses Schauspiel, im höchsten Sinne des Wortes, kann nicht zustande kommen, wenn auch nur eine einzige der aufgezählten Handhabungen versagt hat, eine einzige der elementaren Bedingungen unberücksichtigt geblieben ist. Genauer: das Endergebnis kann nicht ein künstlerisch einwandfreies sein, wenn auch nur einer der vielen, die an seinen Bedingungen mitgearbeitet haben, irgend etwas anderes gewollt, an anders gedacht hat, als in erster Linie an das Gesamtziel: das künstlerische Kinoschauspiel. Es gibt vor allem einen Gesichtspunkt, der namentlich in industrieller Arbeit den des künstlerischen Wollens in den meisten Instanzen weit in den Schatten zu stellen pflegt, nämlich bei den Angestellten[Pg 16] den: wie kriege ich am bequemsten so viel wie möglich Lohn, und bei den Leitern den: wie machen wir soviel wie möglich Geld? Diese Frage und das sie begründende Streben ist vollkommen berechtigt, wenn es sich dem unterordnet: wie mache ich meine Sache so vollkommen wie möglich? Eine Erwägung, die ja wohl an sich mit der erstern nur bei kurzsichtigen Leuten in Widerspruch steht. Und die selber wieder in die Frage ausläuft: wie muß ich’s machen, um zu meinem Teile dazu beizutragen, daß das Endergebnis, das Gesamtprogramm im festlichen, menschenerfüllten Kinotheater ein vollendetes Kunstwerk sei!
Der „Zweck“ aller Kinematographie, und also der Gegenstand auch all ihrer künstlerischen Bestrebungen ist — wie dem Maler das Bild, dem Baumeister das Haus — die wirkliche vollendete Gesamtaufführung. Ihre Ermöglichung teilt sich in zwei sehr verschiedene Tätigkeiten: erstens die Herstellung der nötigen Bilder und Apparate, zweitens ihre Zusammenstellung unter sich und mit andern (Lichtbildervortrag usw.) und ihre Vorführung, kurz die Vorstellung. Wir wollen dementsprechend die künstlerischen Aufgaben der Aufnahme und der Wiedergabe getrennt besprechen. Sie werden von verschiedenen Personen und Berufskreisen ausgeübt, ihre Mittel und Aufgaben sind verschieden, das Gemeinsame an ihnen ist aber dies, daß die Aufnahme und Herstellung der Bilder lediglich dem Endzweck der Wiedergabe dient.
Der Kinoaufnahmekünstler muß sich von zweierlei Gesichtspunkten leiten lassen. Einerseits schwebt ihm die Vorstellung vor, zu der er einen möglichst herrlichen, naturgetreuen und wirkungsvollen Beitrag liefern will — auf der andern Seite ist er sich der engen Grenzen bewußt, die ihm in seinem Streben sein Stoff und seine Technik weisen. Künstlerisch wertvoll kann nur ein Kinobild sein, das eben auf kinematographischem Wege auch das vollendet wiedergibt, worauf es ankommt: nicht also ein schönes Stück kinematographierter Natur, sondern ein schön kinematographiertes Stück Natur. Diese technischen Grenzen der Kinematographie sehen wir aber sehr häufig außer acht gelassen, und daher wollen wir sie uns, soweit sie für die Aufnahme in Betracht kommen, recht klar vor Augen halten.
Der Kinematograph gibt weder alles sich Bewegende wieder, noch gibt er es so wieder, wie das Auge es sieht. Er ist zunächst an sehr enge Beleuchtungsgrenzen gebunden, wodurch neun Zehntel aller Gegenstände für uns von selber wegfallen, darunter fast alle Aufnahmen in geschlossen Gebäuden, selbst wenn sie sehr licht sind. Für unsere Breiten kommen ferner Frühling und Herbst sowie trübe Wintertage kaum in [Pg 17] Betracht, und von den übrigbleibenden nur die hellsten Tagesstunden. (Von Atelieraufnahmen mit künstlichem Licht usw. sprechen wir am besondern Orte.) Sodann sieht unser Apparat nicht wie wir, frei in die Landschaft hinein, er kann nicht sein Auge rechts und links schweifen lassen, noch weniger es abwechselnd auf Nähe und Ferne einstellen. So gibt er also nur einen kleinen, keilförmigen Ausschnitt aus einer Naturszenerie. Ist er auf weit eingestellt (d. h. ein „weitsichtiges“ Glas genommen), so ist der Ausschnitt um so schmaler und spitzer; ist er dagegen nahsichtig (von kurzer Brennweite), so gibt er nur nahe Gegenstände richtig, ferne dagegen verschwommen wieder. Da er nur mit einem Auge blickt, so zeigt er die Gegenstände auch nicht körperlich (plastisch), wie wir sie sehen, sondern bildhaft flach. Er gibt auch ihr scheinbares Größenverhältnis (Perspektive) nicht falsch, aber anders als das Auge, und die Nähe und Ferne verschieden, je nach der Brennweite des Objektivs (Aufnahmeglases) wieder. Meist sind die Gegenstände im Vordergrunde zu groß und hinten zu klein. Dieser Übelstand wirkt besonders auffällig an sich bewegenden Dingen oder Personen, die aus dem Hintergrunde nahend, unnatürlich schnell an Größe wachsen. Auch durch andere Umstände ist die Zahl der Bewegungen, die der Kinematograph „richtig“ wiedergibt, beschränkt. Wie die zum Beschauer senkrechten, so gibt er auch schnelle Querbewegungen, besonders aus der Nähe, falsch wieder: sie lösen sich in ihre einzelnen Augenblicksaufnahmen auf, und erscheinen grob flimmernd. Da ferner der Apparat seine Schaufläche nur mühsam und begrenzt ändern kann, so kann er auch einer ununterbrochenen Fortbewegung in einer Richtung schlecht folgen. Bleiben also als mögliche, mindestens als kinematographisch vollendet wiederzugebende Bewegungen aus technischen Gründen solche übrig, die sich bei genügendem Licht in bestimmter, einigermaßen gleichmäßiger Entfernung auf beschränktem Bildfelde abspielen und auch bei Wegfall der plastischen Erkennbarkeit gut unterscheiden lassen. Diese Bedingungen ändern sich nur wenig, wenn der Apparat selber, z. B. von einem fahrenden Zuge aus, bewegt wird.
Aufs neue schmilzt die Zahl der in Betracht kommenden Aufnahmen gewaltig zusammen infolge des Verhaltens der lichtempfindlichen Schicht gegen Farbenunterschiede. Der Kinematograph gibt Farben an sich überhaupt nicht wieder. Deshalb müssen wir auf all die Naturbilder verzichten, deren Reiz und Herrlichkeit wesentlich in ihrer Farbe liegt. Diese ebenso wie die minder farbigen muß der Aufnehmende im Geiste gleichsam in die „Schwarz-Weiß“-oder Licht- und Schattenwirkung übersetzen, um sich vorzustellen, wie der Anblick im fertigen Bilde sein wird. Der Kinematograph gibt zwar nicht die Farben, aber an ihrer Stelle den Farbenwert in verschiedenerlei Grau „aus[Pg 18]gedrückt“ wieder,— und zwar diesen anders als unser Auge. Uns leuchtend erscheinende Farben, wie rot und gelb, wirken dunkel, dunkle, wie blau, dagegen licht, und das im Kinematographen noch mehr wie sonst in der Photographie, weil hier der Ausgleich mittels besonderer Filmschichten, Gelbscheibe und Entwicklung unmöglich oder doch selten und nur zum Teil möglich ist. Mit Rücksicht darauf muß sich also der Aufnehmende mehr als „Zeichner“ denn als „Maler“ fühlen. Was einem Bilde Ausdruck und Deutlichkeit verleiht, sind große deutliche Umrisse und große gleichmäßig getönte oder gleichsam getuschte Flecken. Jenes reizvolle Vielerlei und Durcheinander in der Natur, wenn es auf Farben oder blendendem Glanz beruht, ist nichts für ihn. Nur dann, wenn es sich auf eine reizvolle „Zeichnung“ zurückführen läßt, wenn ein Vielerlei von „Formen“ ist, wird es auch in seinem Bilde als reizvoller und deutlich erkennbarer Reichtum wiedererscheinen.
Die verschiedenen Verfahren, Naturfarben zu kinematographieren, leiden noch an zu großen Mängeln, und soweit sie überhaupt praktisch verwertbar sind, sind sie noch — wie Urbans „Kinemacolor“ — Monopole einzelner Firmen. Gewiß wird auch hier eines Tages etwas Vollendetes hervortreten; einzelne Kinemacolorbilder sind sogar schon mit Vergnügen zu betrachten. Aber noch sind die technischen Mängel — besonders falsche Wiedergabe der Farbenwerte und das Flimmern — zu groß, um diese Vorführungen in den Kreis unserer Betrachtungen ziehen zu können.
Wir müssen uns ferner bewußt bleiben, daß das kinematographische Bild, eben weil es ja in Wirklichkeit aus Tausenden von Bildchen zusammengesetzt ist, all der individuellen Behandlung in Entwicklung, Fixage und Vervielfältigung, aller Retouche und Nachhilfe unfähig ist, durch die man in eine Augenblicksaufnahme oft eine ganze Menge persönlicher Auffassung hineinzulegen vermag. Selbst in Beziehung auf die Wahl des Bildausschnitts läßt es nicht so viel Freiheit wie das Einzelbild, da eben Rahmen und „Komposition“ des Gegenstandes sich während der Aufnahme in unvorhergesehener Weise ändern können.
Endlich liegt eine Beschränkung, die zwar in jeder Kunst mitspielt, in der Kinematographie besonders nahe: unter all den prächtigen und herzbewegenden Bewegungsbildern in der Natur muß man auf die verzichten, die — zu lange dauern. Der Grund liegt nicht nur darin, daß eben doch die Mängel eines Kinobildes im Vergleich mit einem Naturvorgang so groß sind, daß auch die beste Aufnahme auf die Dauer langweilen würde. Wenn nicht nur Farbe, Plastik, Perspektive und Ausdehnung fehlen oder unvollkommen sind, sondern auch alles, was nebenbei das Ohr hört, Vogelgesang und Donnerrollen, Wasserrauschen und Käfersummen, und was wir fühlen und riechen: Blumenduft,[Pg 19] Luft und Winde — da werden wir uns doch bewußt, daß wir auch im Besitz der Kunst, „die Natur sich selbst aufschreiben zu lassen“, nicht glauben dürfen, sie meistern zu können. Außerdem wirkt aber hier die ökonomische Frage besonders stark mit. Filme sind so teuer, daß eine stundenlange Aufnahme ein kleines Vermögen verschlingt und daher nur gewagt werden kann, wo das Ergebnis etwas von Anfang bis Ende Fesselndes hat. Immerhin sind lange dauernde Aufnahmen technisch nicht unmöglich und finden zuletzt ihre Grenze nur im Hinblick auf die fertige Herstellung, die weder zu lang noch zu eintönig sein darf.
Die rein technische Tätigkeit von der Aufnahme bis zur Herstellung des fertigen Bildes ist zwar im wesentlichen auf die Anregung und Überwachung automatischer Naturvorgänge, ihr vollkommenes Auswirkenlassen und die Auswahl unter ihren Ergebnissen beschränkt, bietet aber eine Menge Möglichkeiten, auch auf das künstlerische Endergebnis einzuwirken. Der Grundsatz muß hier sein, die Echtheit und Wahrheit der Naturselbstwiedergabe in allem zu wahren und zu fördern, und nur da, wo man ohne Verletzung dieser Bedingung die Wahl hat zwischen dem, „wie der Mensch es sieht“ und dem, „wie die Glaslinse es sieht“, sich geschmackvoll nach der Seite des erstern zu entscheiden. Unwahr darf das Kinobild auf keinen Fall werden, aber in allem muß seine Wirkung in der Vorführung als Maßstab vorschweben. Da müssen wir allerdings auf einzelne, an eine vollkommene Vorstellung zu stellende Anforderungen vorgreifen.
Soviel ist klar, daß das bloße Abrollen nach einer guten Naturaufnahme noch kein Kino-Schauspiel ist, oder doch in den seltensten Fällen. Der Vorführer oder Regisseur der Vorstellung muß in der Lage sein, einen Unterschied des Kinobildes von der Wirklichkeit auszugleichen: die Plötzlichkeit und Unvorbereitetheit, mit der es sich abrollt, und die Undeutlichkeit mancher Einzelheiten. Mit andern Worten: ein kinematographisches Bild muß psychologisch vorbereitet und erläutert sowie szenisch ergänzt werden können. (Vortrag, Lichtbilder, Naturgeräusche usw.) Dazu gehört aber vor allen Dingen, daß der Vorführer oder Erläuterer selber weiß, was er darstellt, und daß er mehr davon weiß, als das Bild selbst verrät. So merkwürdig es klingt: trotz zahlreicher geschwätziger oder schwungvoller gedruckter Beigaben und Erläuterungen von Filmfirmen, fehlt doch zu den meisten Bildern so gut wie alles, um dieses Bedürfnis der Regie zu befriedigen. Es bleiben nicht nur fast alle Einzelheiten, die [Pg 20] ein Bild interessant und wertvoll machen, in den meisten Fällen unvermerkt und unerläutert, es sind nicht nur viele der gegebenen Erläuterungen falsch, sondern es sind sehr häufig selbst die Bezeichnungen ganzer Bilder und Szenen falsch. Das liegt nur zum Teil an der Verwechslung der Negative auf dem Wege von der Aufnahme durch die Entwicklungsräume zum Bureau, an ihrer mangelhaften Bezeichnung und unordentlichen Aufbewahrung, an Mißverständnissen und Übersetzungsfehlern oder gar absichtlicher Sucht des Namengebers nach Sensation und Aktualität. Es liegt in der Hauptsache in Versäumnissen bei der Aufnahme, und diese wieder zum Teil in mangelnder Vorbereitung der Aufnahme. Zunächst einmal müßte es selbstverständlicher und eiserner Brauch bei jeder Naturaufnahme (worunter ich jede nicht gestellte geographische, geschichtliche, sonst wissenschaftliche usw. verstehe) sein, daß sich dabei außer dem Kurbeldreher („Operateur“) und seinem etwaigen technischen Gehilfen jemand befindet, dessen einzige Aufmerksamkeit darauf gerichtet ist, den Gegenstand der Aufnahme scharf zu beobachten, über jedes einzelne Vorkommnis genaue Notizen zu machen oder nötigenfalls einem Stenographen zu diktieren. Das letztere wird z. B. nötig, wenn etwa ein Zug von Militär oder hervorragenden Persönlichkeiten, eine ethnographisch interessante Straßenszene, das mikroskopische Gewimmel in einem Wassertropfen usw. aufgenommen wird, oder Naturszenen, die starke Überraschungen und eine Menge interessanter Einzelheiten bieten, wie etwa Vulkanausbrüche o. dgl. Da ist ein Mann, unter Umständen mehrere, vollauf beschäftigt, zu sehen, und können nicht auch noch schreiben. Die Notizen müssen sich auf alles Beachtenswerte erstrecken, und etwa enthalten:
Genaue Angabe von Ort, Datum und Tagesstunde der Szene,
Sinn und Bedeutung des Gesamtvorgangs,
Namen und Kennzeichen aller Einzelheiten, der Örtlichkeit (Berge, Wasser, Ansiedlungen, Bäume, Tiere) und Personen (Name, Aussprache[!], Stand, Tätigkeit im Bilde, Kennzeichen, Einzelheiten der Tracht usw.),
Alle Abschnitte (Phasen) der Szene, Bewegungsvorgänge.
Dabei wahrgenommene, im Bilde nicht wiedererscheinende, daher in der Vorstellung zu ergänzende Nebenerscheinungen, wie vor allem Geräusche (genaue Angaben), Farbenerscheinungen, Reden, Ausrufe, Gespräche, Liedertexte, Tanz- und andere Musik usw.
Bei physikalischen und technischen Aufnahmen außerdem Maßangaben (Messungen), wissenschaftlich nötige oder interessante Einzelheiten, endlich (eventuell):
Metronomische Angaben über das Zeitmaß der Kurbeldrehung bei der Aufnahme, für den Entwickler nötige Angaben über Beleuchtung und technische Einzelheiten der Teilaufnahmen.
Es ist außerdem nötig, daß auf dem Rohfilm selbst an den Stellen, wo ein Bild umspringt (Szenenwechsel), wenn Zeit dazu ist, nicht nur ein Strich, sondern auch eine Notiz (eventuell Zahl) gemacht wird, so daß Verwechslungen ausgeschlossen sind.
Erst eine so vorbereitete Aufnahme kann zum wertvollen Bestandteil einer künstlerisch vollendeten, d. h. hier einfach sachgemäß durchführten und individuell ergänzten Endaufführung werden. Nur sie bietet die genügende Unterlage zum Erläuterungsvortrag, ermöglicht die Vorbereitung der Zuschauer auf wichtige auftauchende Einzelheiten, ihre Einführung in den Wert des Bildes, die intensive Anfeuerung ihres Interesses und Belebung ihrer Phantasie, die Vervollkommnung der Illusion durch Geräuschnachahmung, die Herbeischaffung ergänzender Lichtbilder, die Vorführung im richtigen Zeitmaß. Sie erhöht aber auch den wissenschaftlichen und Sammelwert des Bildes um ein Vielfaches, ja macht es unter Umständen zu einem Unikum. Man glaubt nicht, wie schwierig, ja unmöglich es ist, in vielen, ja in den meisten Fällen auch gute Kinonaturaufnahmen nur einigermaßen ihrem Inhalt nach zu bezeichnen, besonders wenn man in Betracht zieht, daß ein Kinobesitzer endlich nicht die Professoren aller Fakultäten zu Rate ziehen kann. Wer hat alle Städte des Orients gesehen, wer kennt die abergläubischen Zeremonien aller Wilden Polynesiens. Wer ist zugleich mit allen wichtigen Persönlichkeiten einer Staatsaktion, mit jedem Protoplasmaklümpchen im Wassertropfen vertraut, und wer findet sich wiederum ohne weiteres in schwierige Kolbengänge und Räderspiele von Maschinen hinein? Geradezu unmöglich ist diese Forderung dem Kinobesucher selbst gegenüber, der ein Bild, noch dazu mit all seinen optischen Mängeln, zum erstenmal an sich vorbeihuschen sieht. Aber ebenso praktisch unmöglich, mindestens wochen- und monatelange Arbeit erfordernd, ist es in den meisten Fällen auch für den vielseitig gebildeten Berufsmenschen. Dennoch wissen wir alle, daß gerade Natur- und technische Vorgänge, so fesselnd sie rein sinnenmäßig als Bewegung einen Augenblick sein mögen, brennendes Interesse doch erst erhalten, wenn uns gerade jene Wissenseinzelheiten dazu bekannt werden. Jedenfalls kann ein nicht oder nur halb verstandenes Bild nie harmonisch, also künstlerisch wirken. Zum Verständnis aber bedarf jedes Kinobild der Vorbereitung, Erläuterung und Ergänzung, die nur auf Grund von an Ort und Stelle gemachten Notizen möglich sind.
Freilich ist bei wenigem Nachdenken einzusehen, daß es nichts weniger als einfach ist, diese Beobachtungen und Notizen zu machen. Vielmehr[Pg 22] kann das überhaupt nur ein fachmäßig und zugleich vielseitig gebildeter Kenner des Aufnahmegegenstandes. Und dieser wieder wird in den meisten Fällen von den aufzunehmenden Ereignissen einfach überrannt werden, wenn er sich nicht lange vorher eingehend und gewissenhaft aus Fachwerken und Vorstudien auf das zu Erwartende vorbereitet hat.
Nur natürlich ist’s und weiterhin im Interesse des Endzwecks gelegen, wenn eben dieser wissenschaftliche Begleiter auch zugleich der vorbereitende und mitwählende Beirat ist, der vor jeder Aufnahme, ja vor ihrer Vorbereitung gehört wird. Unglaublich viel Film wird an höchst wert- und geschmackloses Zeug verschwendet, und die Firmen wundern sich dann nachher, wenn weder das „Publikum“ sich dafür interessiert, noch auch der so heiß umworbene Gebildete (Schulmann, Fachgelehrte usw.) darauf eingeht. Natürlich kann eine Kinoaufnahme nur vollkommen und dauernd wertvoll sein, die das vom Standpunkt des Kenners Schöne und Wissenswerte aus einem Vorgang — nicht aber irgendwelches mehr oder minder bewegliche Drum und Dran — umfaßt. Das kann aber einer, der der beste „Operateur“ sein mag, nicht beurteilen. Es ist auch eine körperlich unmögliche Aufgabe, zugleich die technische und die künstlerische Seite einer Aufnahme in Beziehung auf Zeitpunkt, Dauer usw. zu beherrschen oder gar sich noch Einzelheiten zu merken und zu notieren.
Von der weitern technischen Behandlung der Aufnahme interessiert uns zunächst die Entwicklung. Diese geht meist sehr schematisch vor sich. Das eingelaufene Negativ wird, vielleicht nach einer kleinen Probeentwicklung, in ganzer Länge vielgewunden um einen Rahmen gewickelt und nun der allgemeinen Lösung ausgesetzt. In Wirklichkeit besteht aber ein solches Filmband meist aus einer Reihe von Einzelszenen, die eine ganz besondere technische Behandlung verlangen. Selbst wenn diese Szenen auseinandergeschnitten und besonders behandelt werden, so ist das doch meistens zu spät, wenn erst die ersten Bilder auftauchen. Gewissenhaft gemachte und beachtete Notizen des Aufnehmenden selbst wären da von größtem Wert. Gerade bei der Entwicklung eines Negativs sollte die Schablone und die Massenarbeit ganz beiseite gelassen werden. Es ist Hand- und Qualitätsarbeit im höchsten Sinne.
Eine Eigenart der meisten Bilder, unter denen die englischen eine rühmliche Ausnahme machen, ist die Härte der Entwicklung. „Schärfe“ zwar — die ja nur vom Aufnehmer abhängt — halte ich für unerläßlich in jedem Falle; künstliche Unschärfe zugunsten irgendeines Effekts wäre unnatürlich. Aber Härte und Grellheit sind zu vermeiden: Lichter und Schatten müssen übergehen, es muß Mitteltöne und nicht nur Gegensätze geben. Das ist vor allem ein Gebot der Schönheit und Vollkommenheit einer Aufnahme und deren Entwicklung, denn nur [Pg 23] so kommen reiche und zarte Einzelheiten zur Geltung. Es ist aber auch ein Gebot der Gesundheit. Jede Vorstellung stellt an sich sehr starke Ansprüche an die Augen, und schon bei der Aufnahme, mehr noch bei der Herstellung der Bilder muß alles willkommen geheißen werden, was zur Schonung der Augen beiträgt. In diesem Sinne kann man auch die sogenannten Tönungen gutheißen — wenn sie diesen und keinen andern Zweck verfolgen. Grelle oder dicke, als „Farben“ wirkende Tönungen, um übertriebene, wunderbare oder gar gefälschte „Effekte“ hervorzubringen, sind Greuel und verderben die schönsten Aufnahmen. Wer kennt nicht tintenrote „Sonnenuntergänge überm Meer“ oder erdigblaue „Mondnächte“? Tönungen müssen sich in zarten, unaufdringlichen Übergängen zwischen den Grundfarben halten. Ein wenig Anklingen an eine im wirklichen Bilde vorherrschende Farbe (grün für Waldlandschaft, blau für Meer und Himmel,) mag ja nicht unter allen Umständen zu verbieten sein, ist aber durchaus überflüssig. Die Tönung ist nichts anderes, als was das Papier für die Zeichnung ist: das gesunde Auge rechnet es nicht mit zum Bilde. Zurückhaltung! Tönungen sollen nur mal eine Abwechslung fürs Auge bieten; sie müssen selten bleiben.
Über farbige Bilder muß ich offen reden. Die Farbengebung der meisten Kinobilder ist Handschablonenarbeit; unendlich mühsam und kostspielig. An eine naturalistische Ausmalung der Einzelheiten ist natürlich nicht zu denken. Es handelt sich nur darum, einige Grundfarbentöne über den Film zu verteilen: grün für Laub, blau für Wasser und Himmel, gelb für Gebäude usw. Bei der Kleinheit des Gegenstandes kann’s nicht fehlen, daß auch mal blaue Menschen und rote Hunde mit durchlaufen. Die ganze Bemalung ist lediglich vom dekorativen Standpunkt aus zu werten: Farben zu sehen, erfrischt nach so viel Grau in Grau das Auge, erleichtert die Unterscheidung und ruht dadurch auch aus. Insofern mag man sich’s dazwischen einmal gefallen lassen, sofern die dekorative stilisierende Absicht deutlich erkennbar ist. Verbrechen gegen den Geschmack sind aber Bilder, die, wie gewisse Varieteeszenen, ein an sich scheußliches Farbengemengsel zeigen, das den Anspruch macht, „malerisch“ zu sein. Das sind farbige Filme niemals, und Firmen, die sich achten, sollten dergleichen ebensowenig wie liederliche, oberflächliche oder aufdringlich kolorierte Sachen herausbringen.
Von größter Bedeutung für das Endergebnis ist nun noch die Tätigkeit des oder der Filmverwalter. Das fertige Negativ wird zunächst dem Chef oder einem Vertreter vorgelegt, die damit wertsteigernd oder entwertend umgehen können. Entwertend, wenn sie mit den einzelnen Szenen herumspielen, die Reihenfolge in unnatürlicher Weise ändern, fremde Bestandteile hinzufügen, zum Verständnis [Pg 24] wichtige Einzelheiten wegschneiden, (mit der bekannten Begründung: „Das interessiert unser Publikum nicht“) ausführliche Szenen kürzen, sensationelle Titel und Erläuterungsphrasen ersinnen, kurz in irgendeiner Weise die Aufnahme fälschen. Sehr den Wert der Aufnahme steigern können sie aber, wenn sie sich mit Hilfe des ersten Positivs, den Sinn des Dargestellten an der Hand der Aufnahmenotizen vergewärtigen, technisch mißlungene Szenen, auch wenn der Inhalt noch so schön ist, unbarmherzig streichen (darunter mindestens alle, die weniger als 10 Sekunden laufen!), und nun ein reichliches Tatsachenmaterial für verständnisvolle Vorführung zur freien Benutzung der Interessenten ausarbeiten lassen. Daß die einzelnen Szenen der zur Aufbewahrung aufgerollten Negative durch zwischengesteckte, herausstehende, kleine Titelblättchen (angeklebt) bezeichnet sein sollten, um später die Stellen für Teilkopien leicht wiederzufinden, erwähne ich nur als besonders bemerkenswertes Kennzeichen der allgemein zu wünschenden Ordnung in der Aufbewahrung. Denn für künstlerische Musteraufführungen ist es oft auch von ausschlaggebender Bedeutung, ob man bestimmte Szenen bestimmter Aufnahmen jederzeit ohne Zeitverlust auffinden und kopiert erhalten kann.
Die Positive sollten zwischen je zwei Szenen (Bildumsprung) einige Zentimeter toten Film (unbrauchbarer Rohfilm oder schichtloser Film, nicht aber bebilderter!) enthalten. Denn es ist, wie wir sehen werden, für eine geschmackvolle Aufführung eiserne Regel, zwischen zwei Bildszenen eine, wenn auch kurze Verdunklungspause zu machen. Das ist aber, besonders ehe der Vorführer sein Bild auswendig weiß, fast unmöglich, wenn die Szenen unmittelbar aneinander geflickt sind.
Von den Aufnahmegegenständen fassen wir zunächst diejenigen ins Auge, denen gegenüber sich der Kinematograph rein als Berichterstatter zu verhalten hat: Aufnahmen von Gegenständen und Experimenten zu Zwecken wissenschaftlicher, technischer, schulmäßiger Belehrung oder Bekanntmachung, zu Archiv- oder Propagandazwecken. Ein Vergleich mit der Augenblicksphotographie erinnert uns, daß auch diese Aufgabe künstlerisch gelöst werden kann und muß. So gut wie die Photographie von Maschinen, Waren, Innenräumen, Kunstwerken usw. heute das Alleingebiet von Photographen ist, die in ihrer Art Künstler sein müssen, so und noch mehr muß es die kinematographische Wiedergabe entsprechender Sachen sein. Die schaudernde Erinnerung an so manche pomphaft angekündigte kinematographische Abbildung von Maschinen und Werkstätten im Betriebe, von [Pg 25] Fabrikationsvorgängen oder landwirtschaftlichen Arbeiten, selbst von Trachten und Moden genügt zum Verständnis unserer Forderung. Was nützt uns ein Tohuwabohu riesiger Hände, die im Wahnsinnstempo allerlei rätselhafte Manipulationen ausüben, was ein Durcheinander von Rädern und Stangen, von denen einige mal da und mal da verschwunden sind, wir wissen nicht warum?
Der Hauptfehler, der hier gemacht wird, ist die ungenügende Berücksichtigung der Tatsache, daß die Rundheit (Plastik) der Gegenstände in der Kinematographie verloren geht, und daß sich Hinter- und Vordergrund nicht voneinander abheben. Ein weiterer Fehler, daß man nicht bedacht hat, daß das Auge nicht mehrerlei zugleich zu sehen und zu deuten vermag, und daß es nicht darauf ankommt, das zu photographieren, was sich am meisten und sichtbarsten bewegt, sondern diejenigen sich bewegenden Teile, die die eigentliche Arbeit tun. Es trägt nichts zum Verständnis einer Nähmaschine bei, daß der Fußtritt auf- und abwippt, und das Rad sich dreht, während die Nadel einen rasenden Tanz vollführt.
Bei allen derartigen Aufnahmen ist die Herausschälung und Heraustrennung des jeweils einen Arbeitsvorganges, auf den es ankommt, erste Bedingung. Zunächst muß dabei (in der Regel; feste Vorschriften lassen sich nicht geben, nur Hinweise) der natürliche Hintergrund völlig abgetrennt werden. An seiner Stelle ist eine gleichmäßige Fläche anzubringen, deren Schattenwert sich von dem der in Betracht kommenden Gegenstände möglichst gleichmäßig unterscheidet. Desgleichen wird es sich empfehlen, etwa bei Maschinen, die abzubildenden arbeitenden Teile so zu umkleiden oder zu überstreichen, daß sie ebenfalls bestimmte, ruhige, die Unterscheidung erleichternde Tonwerte im Bilde erhalten; vor allem sind blendende Teile so zu behandeln, die im Bilde geradezu hypnotisierend wirken. Nun sind diejenigen Bewegungen auszuwählen, die sich, nötigenfalls unter Verlangsamung, kinematographisch deutlich wiedergeben lassen. Alles andere ist überhaupt wegzulassen; zu seiner Darstellung muß man entweder besondere Modelle machen, oder es dem ergänzenden Lichtbild oder der Worterklärung überlassen. Einer der verwerflichsten Fehler solcher Bilder (manchmal allerdings nur auf der Wiedergabe beruhend) ist das übertriebene Zeitmaß entweder der Aufnahme oder der Bewegungen selbst. Es entsteht, indem entweder die Aufnahme zu schnell oder die Wiedergabe zu langsam gemacht wird. Mag das den Zweck haben, Film zu sparen, oder will man dem Beschauer imponieren, oder hält man überhaupt den Vorgang in seiner natürlichen Abwicklung für zu langweilig: in jedem Falle ist es liederliche Arbeit, die auf künstlerischen Wert keinen Anspruch hat. Ein weiterer hier beliebter Fehler ist die viel zu kurze Dauer der einzelnen Aufnahmen. Das Auge muß[Pg 26] sich an das kinematographische Bewegungsbild noch viel mehr als an das wirkliche gewöhnen, ehe es etwas davon versteht, ja es überhaupt erfaßt. Bei Bildern von 2 oder 3 Sekunden Dauer, wie man sie häufig zählen kann, ist das unmöglich. Dieser Sparsamkeit steht auf der andern Seite viel zu große Ausführlichkeit in der Wahl der Szenen gegenüber. Der Aufnehmende hat nicht das künstlerische Endziel — das Bild auf der Leinwand — im Geiste vor sich, nicht was da wirkt, ist für ihn maßgebend. Vielmehr zählt er sich auf, aus welchen Einzelheiten theoretisch ein Fabrikationsvorgang o. dgl. besteht, und glaubt nun, er müsse von jeder dieser Einzelheiten ein wenn auch völlig unverständliches Pröbchen zeigen. Das ist natürlich Unsinn. So wie ein Redner, um einen Vorgang klarzumachen, ihn nicht weitschweifig von Anfang bis zu Ende erzählt, sondern das Wichtigste und am besten Darstellbare herausgreift, das aber auch gründlich, deutlich und eindringlich behandelt — so muß es der Kinokünstler angesichts solcher Aufgaben tun. Natürlich muß er sich da von Sachverständigen beraten lassen.
Ein nicht auszurottender Aberglaube scheint es endlich zu sein, daß derartige Ausnahmen nicht anders eingeleitet, beschlossen und zwischendurch geziert sein dürfen als mit irgendwelchen Mätzchen: komisch sein sollende Grimassen von Arbeitern, kokette Blicke weiblichen Ursprungs, Possen und Albernheiten oder auch Scherze, die erzählt vielleicht nicht unwirksam sein würden, kinematographiert aber widerwärtig sind. So sah ich z. B. einen Film, der die Entwicklung — ich glaube von Käsemaden — zeigte und eingeleitet wurde durch den überlebensgroßen Kopf eines Mannes, der höchst affektiert ein Käsebutterbrot kaute, und es dann durch eine Lupe besah. Der Hersteller hatte an die zu einer Einleitung passenden Worte gedacht. „Wenn mancher wüßte, was er alles mit und in einem Käsebutterbrot verzehrt, so würde er wohl.... usw.“ Er hatte aber nicht Stilgefühl, Geschmack, künstlerische Sicherheit genug, um zu bemerken, daß eben dieser Gedanke literarisch-rednerischer Verwertung vorbehalten bleiben muß, nicht aber sich kinematographieren läßt. Aus dem einfachen Grunde, weil er sich in einem wenige Sekunden dauernden Satze klar und appetitlich ausdrücken läßt, während man ihn aus einem langen, quälenden Kinobild, wie aus einem Bilderrätsel, doch nur mühsam und unsicher errät.
Das ist ein Gesetz für alle Kinoaufnahmen, daß man sich auf Bilder beschränken muß, die etwas ausdrücken, was sich eben nicht auf anderm Wege — Wort, Lichtbild, Musik usw. — etwa kürzer, besser und verständlicher machen läßt. So besagt das Augenblicksbild einer ruhenden Maschine (Diapositiv) in den meisten Fällen für ihre Gesamtanlage viel mehr als eine Kinoaufnahme, in der die großen, ganz äußerlichen, unruhigen Bewegungen eher stören. Um etwas klarzumachen, [Pg 27] ist die Kinematographie unter allen Umständen nur ein Hilfsmittel, und nicht das vollkommenste. Dessen muß sich der Aufnahmekünstler bei technischen Aufnahmen besonders bewußt sein und in der Beschränkung seine Meisterschaft suchen.
Alle kinematographischen Bilder, die nicht „Dramen“ u. dgl. Szenisches darstellen, führen auf dem Programm und in der Sprache der Kinofachleute den seltsamen Namen „Aktuelles“. Damit pflegt man in der Zeitungssprache Sachen zu benennen, die nur eine Bedeutung für den Augenblick haben, Tagesereignisse usw., die morgen vergessen sind, für „heute“ aber um so brennenderes Interesse haben. Die Kinoleute verstehen darunter aber nicht nur Tagesereignisse, wie Paraden, Besichtigungen, Morde, Unglücksfälle, oder die Stelle davon, „wo es gewesen ist“, Modeschöpfungen usw., sondern überhaupt alle „Natur-“, technischen, industriellen, gewerblichen, geographischen, ethnographischen, zoologischen, botanischen und sonstigen naturwissenschaftlichen Bilder, Sport- und Militärszenen usw. Diese Benennung, die die Verhältnisse, wie sie sein sollten, umdreht, ist bezeichnend für den Geist oder die Gedankenlosigkeit, die heute die kinematographische Erzeugung und Vorführung beherrscht. Denn „aktuelle“ reine Tagessachen sind doch in Wirklichkeit die szenischen Bilder, besonders die „Dramen“ und Possen, die eine Woche lang das künstlich aufgestachelte Interesse des Publikums reizen und danach weder mehr verlangt werden noch irgendwelchen Wert haben. Es sind Feuerwerke, sensationell, kostspielig, aber vergessen wie verpufft. Gerade die andern Aufnahmen aber, die in den Programmen wie in den Prospekten der Filmfirmen etwa ein Zehntel bis ein Achtel der Gesamtbilder ausmachen, gegen neun Zehntel bis sieben Achtel der „Dramen“, sind diejenigen, von denen selbst die geringsten, einigermaßen richtig behandelt, geradezu Ewigkeitswert haben würden — weil doch selbst die geringsten davon Dokumente von Wirklichkeiten sind. Es ist überaus bezeichnend, daß die Kinoleute gerade diese Bilder nur unter der in den meisten Fällen sogar unzutreffenden Etikette der „Aktualität“ in ihr Programm spärlich einzuschmuggeln wagen. Nur darin, daß sie wirklich oder angeblich an irgendein Tagesereignis anknüpfen, erblickt man ihren Wert, und nur darum setzt man sie den Leuten vor. Und wer diese Bilder ansieht, findet denn auch meistens: sie sind danach. Es sind zum großen Teile flüchtig und verständnislos aufgenommene Bilder, die dem Namen nach mit irgendeinem Tagesinteresse zusammenhängen. In Wirklichkeit sucht man oft vergebens nach dem tatsächlichen Zusammenhang, oder man findet ihn in einer lächerlichen [Pg 28] oder ärgerlichen Nebensache. Wohl das albernste dieser Art, worin sich aber das Kino auf den wenig entschuldbaren Vorgang gewisser illustrierter Blätter berufen kann — sind die Bilder zu solchen Ankündigungen wie: „Das große Eisenbahnunglück bei X.“, „Das Erdbeben zu Y.“ usw. Das Bild zeigt in Wirklichkeit nichts von diesen Ereignissen als ihre Nachwirkung, oder auch bloß den Ort, wo sie stattgefunden haben. Das wäre schon minder lächerlich, wenn es dementsprechend ehrlich angekündigt würde. Dann aber würde es allerdings wenig mehr „ziehen“, weil sich die Besucher mit Recht sagen würden, daß man sich eine tote Trümmerstätte — falls sie überhaupt Interesse biete — am wenigsten in einem Kinematographen ansehen wird.
Ähnlich oberflächlich und äußerlich ist das Verhältnis des Kinematographen zu andern Tagesereignissen — wie sich schon in der Auswahl kundtut. Was davon kinematographiert wird, ist fast ausnahmslos nur der mehr oder weniger glänzende Schaum des Tages. Aufzüge, Paraden, Fürstenbesuche, Begräbnisse, Rennen, Unglücksfälle — jede Woche aus einem andern Teile der Welt, und jede Woche dasselbe. Und immer aus all diesen Ereignissen, unter denen gewiß manches auch sein tieferes Interesse hat, die langweiligsten und von ihnen die nebensächlichsten Dinge ausgewählt. Gewiß, es interessiert uns, die Staatsoberhäupter mal zu sehen — aber es interessiert uns nicht im geringsten, immer wieder auch ihre Sonderzüge, geschmückte Bahnhöfe, wartende Frackmenschen, begleitende Uniformen zu sehen. Ja, wenn wir mit den bedeutendern darunter befindlichen Persönlichkeiten bekannt gemacht würden! Aber davon ist meist keine Rede. Oder wenn uns bei der Gelegenheit ein Einblick in fremde Länder und Großstädte, Volks- und Gesellschaftsszenen gegeben würde, wenn wir sähen, was derlei Dinge in London, Paris, Neuyork, Bombay, Yokohama, aber auch in den Dörfern oder Kleinstädten der Bretagne oder Schottlands von denen in Berlin oder Tangermünde unterscheidet! Aber gerade das wird uns ängstlich unterschlagen. Nur was sich an international gleichförmigen Untiefen an den großen, leicht zugänglichen Verkehrsorten ansammelt, zeigt uns der Kino. Das Bezeichnende, dauernd Wertvolle fehlt. Die Bilder sind von äußerst geringem aktuellen Wert, gerade weil der Sinn für den dauernden, geschichtlichen und kulturgeschichtlichen Wert der Tagesereignisse fehlt.
Gerade hier liegt aber wieder einer der Schwerpunkte der Kinematographie versteckt, gerade hier harren ihrer die stolzesten und dankbarsten Aufgaben. Gerade hier vermag sie auch um künstlerischen Lorbeer zu ringen, den ihr keine andere Darstellungstechnik streitig machen kann.
Um Tagesaufnahmen dieser Art wertvoll zu gestalten, sie zu [Pg 29] künstlerischen Leistungen hohen Ranges zu erheben, muß man sie „sub specie aeternitatis“, „unter dem Gesichtswinkel der Ewigkeit“ oder doch wenigstens des spätern Geschichts- und Kulturgeschichtsschreibers zu sehen suchen. Da schmilzt das Pomphafteste und Glänzendste oft zu einem Nichts zusammen, und das Geringfügigste schwillt zu leuchtender Bedeutung. Was aber ist’s, das alle Dinge glänzend oder unscheinbar, zu geschichtlicher oder kulturgeschichtlicher Bedeutung erhebt? Ihre innere Wahrhaftigkeit, ihre Echtheit, Unmittelbarkeit, vermöge deren sie der Ausdruck der großen Gedanken, Gesinnungen und Interessen sind, die das Leben eines Volkes im öffentlichen und im häuslichen Kreise zu einem bestimmten geschichtlichen Zeitpunkt ausmachen. Das Begräbnis eines großen Volksführers, der blumenbeladene Sarg, die schwarzen Pferde, der billig und geschmacklos verzierte Leichenwagen, die langen Reihen wandelnder Hüte und Schirme — was daran „Ausdruck“ einer Zeitströmung, was daran kulturgeschichtlich interessant ist, dafür genügt irgendein alltägliches Beispiel als Beitrag zu dem Stoffgebiet: Begräbnissitten bei den Deutschen des 20. Jahrhunderts. Wonach wird aber das Auge des Beschauers nach einigen Jahrhunderten einmal suchen? Nach Zeichen dessen, was echt hierin ist, nach mehr oder minder großem Ernst, innerer Ergriffenheit Beteiligter, vielleicht auch nach dem Auftauchen von Persönlichkeiten, die eine über ihre Zeit hinaus als wichtig empfundene Rolle spielen. Warum also lange Bilder von Sargträgern und Türöffnern, Droschken und Regenschirmreihen? Der Aufnehmende suche einen Platz, von dem aus vor allem Erkennbares zu erfassen ist, und wähle einige wenige, aber bezeichnende Szenen aus. Dasselbe bei Paraden, Prunkzügen, Fürsteneinholungen usw. Gewiß, es gibt da stets einiges brennend Interessante. Aber das, nur das muß aufs Bild kommen, das aber auch groß und deutlich, möglichst frei von störendem Beiwerk. Jede Gegenwart hat den Drang, ihre Lebenserscheinung durch Pomp und suggestives Beiwerk zu fälschen, das Echte und Ursprüngliche zu überdecken, den erwünschten Schein durch Gebärden und kostspielige Pracht übermächtig zu machen. Der Kinematograph ist nur ein Stümper, der darauf hereinfällt. Und vor allem: das dem Auge der Nachwelt zu erhaltende Leben beschränkt sich überhaupt nicht auf die Vorgänge, von denen die Zeitung unter „Politik“, „Lokalem“ oder „Vermischtem“ breit und wichtig berichtet. Schon unendlich viel wichtiger, weil ehrlicher, ist das ganz gewöhnliche, sich unbeachtet wähnende Alltagsleben. Haben nicht die Maler und Zeichner aller Zeiten sich heiß bemüht, gerade dies festzuhalten: das Leben des Alltags in Arbeit und Erholung, in Dorf und Stadt? Sitzt man nicht stundenlang an der Kreuzung zweier jener Großstadthauptstraßen, oder an einem Dampferlandeplatz, in einer Markthalle, vor einer[Pg 30] Schmiede oder dem Dampfkrahn in einem Hafen, um das „Leben und Treiben“ zu beobachten? Macht nicht jeder Neuankömmling in Berlin, London oder Paris ein oder mehreremal seine Fahrt auf dem Omnibusverdeck über das Meer des brandenden Lebens hinweg? Und nun stellen wir uns einmal vor: wir hätten heute ein Bild vom Töpfermarkt in Athen oder von der Promenade bei den Tuilerien zur Zeit von 1789 oder die Aufnahme einer stillen, sonnigen Stunde vor Goethes Gartenhäuschen bei Weimar. Ein paar Gestalten in der idyllischen Tracht jener Tage wandelten vorüber, und es käme vielleicht ein kleiner Mann daher, von seinen Hunden begleitet, und verschwände in jener umlaubten Tür — wir hätten einen Besuch des Großherzogs bei Goethe belauscht. Was wären wir wohl bereit, Eintritt zu zahlen, wenn wir so manchen Großen oder Kleinen, dessen Name heute unser Herz höher schwellen macht vor Ehrfurcht oder es durch seine Liebenswürdigkeit gefangen nimmt, sehen könnten? All jene Helden der Künste und Wissenschaften, der Arbeit und des Krieges, die zu ihrer Zeit doch nicht in Denkmals- oder Photographiepose, dafür aber echt und lebendig im Kulturrahmen ihrer Zeit wandelten?
Freilich, hier brennt’s uns allen auf den Lippen: ein Wachsfigurenkabinett der Vergangenheit würden wir keineswegs sehen wollen. Das, was solchen kinematographischen Bildern einzig und allein Wert verleihen würde, dann aber auch unausdenkbaren Wert, das wäre: ihre Echtheit. Ihre Ungewolltheit, das Fernsein jeder Pose und jedes Photographierbewußtseins. Das allein ist ja wieder die Stärke unserer Kunst, während Malerei und Photographie, Bühne und Geschichtsschreibung, Selbstbiographie und Memoirenliteratur in der Herausarbeitung feiner oder grober Pose doch unübertreffbar sind.
Hier erkennen wir eine weitere Grundforderung an den „Aktualitäten“-Kinematographen: belausche deine Opfer, photographiere sie, ohne daß sie es wissen. Wenn sie es wissen, sind sie alle aus ihrer eignen Haut heraus. Die einen schreiten, statt zu gehen, rollen die Augen und streichen den Schnurrbart, lächeln und winken — die andern sind nervös und finster, gereizt und ablehnend; und wenn einer sich noch so sehr bemüht, unbefangen zu bleiben, so wird’s doch um so mehr „gewollte Unbefangenheit“. Hat man Erlaubnis nötig, so hole man sie nachträglich ein. Wenn man vorher die Gelegenheiten genau studiert und nötigenfalls Mittelspersonen ins Vertrauen zieht, so gibt es Mittel genug, um dem Kinematographen ausgiebig zu erlauben, was sein gutes Recht, seine Kultur- und Geschmackspflicht ist: das unbefangene Leben zu belauschen.
Es erweitere also der Tageskinematographist sein Gebiet und fasse nicht nur die äußerlichsten Prunk- und Sensationsereignisse des Tages, die „Haupt- und Staatsaktionen, Unglücksfälle und Verbrechen“ [Pg 31] ins Auge, sondern auch das Leben von Künsten und Wissenschaften, Geschäft und Börse, Handel und Wandel, Sitten und Ideen. Das erfasse er so heimlich wie möglich da, wo es sich in packenden, lebensvollen Szenen verdichtet, und trete da nahe genug heran, um das auch auf den Film zu bekommen, worauf es ankommt: seelischen Gehalt und feinen Ausdruck. Er kinematographiere den „Zeitgeist“.
Aber, erwidert man mir, wir kinematographieren nicht für die Nachwelt, sondern für die Gegenwart. Die bezahlt uns bar; was nützen uns die Liebhaber und Interessenten nach hundert oder tausend Jahren?
Sie nützen uns. Sie lehren uns nicht nur, schärfen nicht nur unsern Blick für das, was nach Jahrhunderten „wissenschaftlich wertvoll“ sein wird, sondern damit zugleich für das heute wahrhaft Packende und Wirksame. Was macht uns denn unsern Alltag interessant? Das Alltägliche drin, was wir beständig sehen, was uns zum Gewohnten geworden ist? Nein: nichts als eben jene Züge, die die flüchtige Gegenwart zu einem Bestandteil des unaufhörlich unter ihr hinrauschenden Stromes der Geschichte und Kulturgeschichte machen. Wir selber sehen so nur hinein, wie man in das Plätschern auflaufender Wellen an einem Uferwinkel blickt. Erst dadurch, daß unsere Augen für das die Zeit Überdauernde in diesen Dingen geöffnet werden, erst dadurch, daß wir ihn mit den Augen unserer Nachfahren sehen lernen, wird unser Alltag uns zu einem Bilde von brennendem Interesse. Das eben muß der Kinematograph uns zeigen — dann dient er sich, indem er uns zu einem dankbaren Publikum macht. Indem sich der Aufnehmende in die Rolle des großzügigen Geschichtsschreibers für künftige Geschlechter denkt, wird er zum hinreißenden Schilderungskünstler für die Gegenwart.
Dann erweitert sich ihm auch sein Gebiet noch mehr. Unser öffentliches Leben, das so uniform scheint, zusammengesetzt aus Geschrei und Gebärden, die an allen Stellen des Erdballs gleich sind, wo sich „zivilisierte“ Menschen zusammengeballt haben, ist nur ein dünner Firnis über dem wirklichen, intimen Volksleben. Das gärt und wirrt darunter — ein unübersehbares Leben voller eigenartiger Sitten und Gebräuche, Trachten und Feste, uralter, oft zu unbewußt gewordenen Alltäglichkeiten erstarrter, seltsamer Überlieferungen voll einstiger tiefer Bedeutung. Da leben alle Zeitschichten der Kulturentwicklung von der germanischen Urzeit bis zur weltstädtischen Überfeinerung, von durchsichtiger Lasur überdeckt, auf den verschiedenen Bodenarten des Landes nebeneinander. Da haben alle einzelnen Berufe in Dorf und Stadt eine Menge Eigentümlichkeiten, aus alter oder neuerer Zeit stammend, die alle einst verschwinden werden. Die Tänze, die Familien-, Jahres- und Ortsfeste schälen sich, je mehr man sie in ihrer Unberührtheit aufsuchen[Pg 32] gelernt hat, immer reiner und glänzender in überlieferter Schönheit und altem Sinne unter Biergärten- und „Restaurant“-Betrieb heraus. Noch das Botenfuhrwerk zwischen Stadt und Land würde, getreulich kinematographiert, in seiner ausgeprägten Eigenart seltsam erscheinen, wie ein Bild aus einer andern Welt.
All diese Dinge, denen sich noch viele anreihen ließen, wären, verständnisvoll und mit künstlerischer Vollendung kinematographiert, im heutigen Kino von ebenso hinreißender Wirkung wie für eine Zukunft von oft unberechenbarem Werte. Künstlerisch vollendet würde auch darum schon ihr Wert steigen, weil dann, aber auch nur dann, Sammlungen und Archive, vor allem auch sammelnde Liebhaber, sie zu erwerben trachten würden. Denn daß ihr Sammelwert unbedingt steigen würde, das dürfte ja wohl keinem Zweifel unterliegen. Auch hier harrt der Kinematographie noch eine große, kaum im rohesten in Angriff genommene Aufgabe.
Was hier gesagt worden ist, gilt natürlich entsprechend für völkerkundliche (ethnographische) u. dgl. Aufnahmen in allen Landen. Das blöde „Aufnehmen“ des ersten besten, was dem Gesellschaftsreisenden an Sichbewegendem vor Augen kommt, hat da gar keinen Wert. Hier kommt in erhöhtem Grade noch die Kunst in Geltung, Aufnahmen ohne Wissen der Betreffenden zu machen oder aber — vielfach unvermeidbar — eine solche Anordnung zu treffen, daß die unbefangene Wirklichkeit aufs Bild kommt. Die allein hat Wert.
Was wir im bisherigen immer wieder betonen und im einzelnen deutlich zu machen bestrebt sein mußten: die Pflicht der Sachlichkeit, Deutlichkeit, Großzügigkeit, des Suchens nach dem geistigen Gehalt, dem „Bedeutenden“ in einem Vorgang, die Pflicht der vornehmen Selbstbeschränkung als Voraussetzung auch des künstlerischen Wertes aller Kinoaufnahmen — das gilt im selben Grade natürlich auch für die Menge der „naturwissenschaftlichen“ Filme. Und es ist für sie ebenso, wenn nicht noch mehr, nötig, an diese Forderungen zu erinnern. Was man in Kinos an geographischen, ethnographischen, zoologischen, botanischen usw. Bildern sieht, hat in den meisten Fällen — im Gegensatz zum hochpreisenden Titel — schon sachlich einen sehr geringen Wert. Es beunruhigt den Kenner und stößt ihn zuletzt ab, weil es selten oder nie Darstellungen dessen sind, was an dem Gegenstand für den Kenner und den denkenden Menschen das Wertvolle und Wesentliche ist — sondern irgendeine, vom Schiffbord oder der Heerstraße der Cook-Reisenden aus leicht „mitzunehmende“, sich bewegende Nebensache. Was hier zu fordern ist, worauf es ankommt, werden wir Gelegenheit haben, in einem andern Bändchen dieser Reihe darzustellen.[Pg 33] Jetzt wollen wir diesen Punkt verlassen und uns dem zuwenden, was wohl den reizvollsten Gegenstand der Kinematographie ausmacht, worin sie ihre mächtigsten künstlerischen Wirkungen zu erzielen vermag: der Darstellung der Schönheit der natürlichen Bewegung an sich.
Ja, das ist ja das Eigenste unserer Kunst: die Bewegung der Dinge in ihrem vollen Reichtum und ihrer unverfälschten, unbefangenen Schönheit bildlich festzuhalten! Das ist ja das unerhörte Können in der Hand des menschlichen Geschlechtes von nun an: dieses Alles-, Echt- und Lebendig-Malen! Dies das verheißungsvolle, sinn-, herz- und hirnbildende: Millionen die Augen öffnen zu helfen, ihrem Gemüt nahe zu bringen diese unerschöpfliche Schönheit des Alltäglichen um uns: dies millionenfache Leben und Sichregen in Form und Farbe, Licht und Linie, dies Schwellen und Breiten, Hasten und Flimmern, das erschütternd Große und das nervbebende Kleine! Was für ein Feld eröffnet sich da dem Aufnahmekünstler, zu sehen, zu wählen, zu verkünden, zu begeistern! Wenn das Leben eines Michelangelo nicht reicht, um die Fülle des Formenspiels auf dem menschlichen Körper zu fassen, wenn Max Liebermann nie auslernen wird, das Spiel von Licht und Farbe auf Kohlfeldern und badenden Knaben nachzutasten — wird es künftig die nicht zu erschöpfende Lebensaufgabe von Generationen von Kamerakünstlern sein, die Schönheit der natürlichen Bewegung auf dem Filmbande zu fangen und zu entwickeln. Um so weniger können wir hoffen, mit der Feder irgendetwas mehr davon zu geben, als den Weg zu zeigen, um auch auf diesem Gebiete vom Pfuschen und Patzen, vom Kleben am Stoff und an der „Sensation“ zum künstlerischen Schaffen zu gelangen. Als ein Haupthindernis für das bisherige Gedeihen dieses Zweiges der Kinokunst muß das Vorurteil bezeichnet werden, daß reine Naturaufnahmen „erfahrungsgemäß“ „unser Publikum“ nicht interessieren. Dem können wir hier nur entgegensetzen: „Erfahrungen“ in dieser Frage gibt es außerordentlich wenige, und diese wenigen beweisen das Gegenteil. Wo wirklich — sei es durch die ausnahmsweise kostspielige und mühsame Bemühung eines Begeisterten, sei es als mit-„untergelaufenes“ Endchen Film etwa in einem in freier Natur gestellten Schauspiel — Zuschauer einmal Gelegenheit hatten, Naturaufnahmen, die die „Schönheit der natürlichen Bewegung an sich“ darstellen, zu sehen, da habe ich stets nur Ausrufe des Entzückens, bei einigermaßen zulänglicher Dauer jubelnde Begeisterung bemerkt. Dafür hat jedermann Sinn — nicht nur „Gebildete“, sondern ebenso Bauern, Arbeiter, Kinder und Dienstmädchen. Allerdings liegt es auch an der Vorführung, d. h. der Programmzusammenstellung. Ein Film voll feiner Schönheit darf nicht von vor- und nachkommenden „Radau“-Bildern [Pg 34] totgemacht werden. Er muß sich auswirken können. Von dem hierzu Nötigen sprechen wir später.
Naturaufnahmen der in Rede stehenden Art, mit vollem künstlerischen Bewußtsein zum genannten Zweck gemacht, sind freilich so selten, daß man sagen kann, sie laufen nur zufällig mal mit unter. Das Beste der Art, das man zu sehen bekommt, ist unter einem ganz andern Gesichtspunkt gemacht: dem der „Sensation“. Der Titel spricht allemal von „den größten ...“, „den schönsten ...“ (nicht „schönen“!), von „gigantischen ...“, „weltberühmten ...“ usw. Naturschauspielen. Nur unter diesem Gesichtspunkte bekommt man einmal die Niagara- oder Viktoriafälle, die Geiser Neuseelands, Meeresbrandungen am Golf von Biskaya, Eisberge u. dgl. zu sehen.
Wenn man aber recht beobachtet, so wird man finden, daß es — wie auch in der Natur selbst — gar nicht die räumliche Ausdehnung, die Außergewöhnlichkeit ist, durch die so ein Schauspiel die Zuschauer fesselt, sondern im Gegenteil: gerade das Gewöhnliche, das Typische, die Regelmäßigkeit, das in aller Welt sich Gleichbleibende, Intime daran. Was mitwirkt, wenn wir gerade die Niagarafälle im Bilde sehen, ist nicht ihre Größe — für die uns dem Kinobild gegenüber der richtige Maßstab fehlt — und nicht ihre Weltberühmtheit — die den meisten heutigen Kinobesuchern ein Geheimnis ist —, wohl aber ihre größere Deutlichkeit und Übersicht. Zeigt mit gleicher Deutlichkeit und Übersicht (wozu allerdings die eigenste Gabe des Kinokünstlers, das Wahltalent, brennend nötig ist), den einfachsten Wasserfall in eurem nahen Walde, das Auflaufen der Wellen auf den Uferkieseln eures Flusses oder Dorfbaches, das Spielen des Lichts im Blätterwerk eurer Garteneinsamkeit, laßt statt linkisch erhaschter Tiger und Elefanten Rehe, junge Hasen, Amseln im Blätterteppich, Schmetterlinge um Blumen, Bachstelzen und Möven über den Wellen als „Staffage“ auftreten, und — wenn ihr’s mit künstlerischer Sicherheit gemacht habt — wird die Wirkung gleich, oft größer sein. Denn die Natur ist im Kleinsten wie im Größten gleich reich, gleich wahr, von den gleichen, gewaltigen Gesetzen beherrscht,— gleich schön.
Es ist nicht die Größe der Bewegungsträger in der Natur, wodurch sie fesselt, sondern das all ihre Bewegungen gleichmäßig beherrschende, ahnungsvolle Gesetz der Schönheit. Der Rhythmus ist das Geheimnis dieses Gesetzes. Der Rhythmus, der gleich packend zu uns spricht aus dem regelmäßigen Anschlagen der Meereswellen an das Ufer — gleichsam in immer wiederkehrenden gleichen Strophen — im unzerlegbaren unendlichen Herniedersinken weiter Wassermassen und Nebelstaubsprühen großer und kleiner Wasserfälle — einem epischen Gesang vergleichbar — wie im stoßweisen Erzittern, langsamen Sichneigen, schnellen und immer schnellern Hinsinken der gefällten[Pg 35] Tanne und dem nachfolgenden Hochemporsteigen einer Wolke von Staub und Erde. Das ist das Drama, die „Handlungs“-Dichtung der „Bewegung an sich“. Nichts Willkürliches darin, das Sichtbarwerden eines Gesetzes, von Ketten kosmischer Ursachen, Schritt für Schritt erwartet und doch erstaunend, ungeheuer packend, in seiner majestätischen Wirklichwerdung.
Die Schönheit dieser Bewegung fließt aus zweierlei Quellen, deren beider Darstellung Eigenrecht des Kinematographen ist: der körperlichen Bewegung der Dinge selbst und dem Spiele des Lichtes auf und in ihnen. Beide sind unberechenbar, obgleich beide durch das Gesetz des Rhythmus gebändigt; und durch beider Zusammenwirken entsteht im kleinsten Wassertropfen, auf dem einfachsten Blätterzweig selbst in scheinbarer „Ruhe“ eine Welt von Bewegungsschönheit. Wer den Blick dafür erworben hat, kann ihr in der Wirklichkeit stundenlang zuschauen. Warum nicht auch ihrem Abbild auf der Projektionsleinwand?!
Diese „Ruhe“ ist geradezu das andere Wort, womit ich ebenfalls das Schönheitsgeheimnis der natürlichen Bewegung auszudrücken vermöchte. Auch das ist etwas, das von den meisten Aufnehmern nicht begriffen wird. Je unruhiger, zappeliger, unübersichtlicher, dem gewöhnlichen Auge aber auffälliger eine Bewegung ist, für desto geeigneter zur Aufnahme halten sie sie. Das ist gleich falsch vom Standpunkte des Beschauers wie des Kinotechnikers. Hastige Bewegungen „kommen“ im Bilde gar nicht als solche, man denkt sie sich (Schornstein im Höhepunkt des Falles, plötzliche Armbewegung!) in Wirklichkeit bloß dazu. Unverarbeitete, regellose, grelle Bewegungen werden im Bilde nur zum Teil vom Auge erfaßt, vom Gehirn aber nicht verarbeitet, nicht „begriffen“. In der Natur aber suchen wir derartige Bewegungen nicht. Sie haben etwas Beunruhigendes, Erschreckendes, Unbefriedigendes, Abstoßendes für uns. Nicht weil sie nicht an sich ebenfalls durchaus gesetzmäßig wären, sondern weil wir infolge der Mängel von Auge und Hirn diese Gesetzmäßigkeit schwer oder gar nicht zu übersehen vermögen. Worauf unser Auge verweilt, was wir auf Wanderungen und Reisen, in unsern Gärten und Springbrunnen um seiner Schönheit willen suchen, das ist das ruhige, immer sicht- und erkennbare und dabei immer geheimnisumhüllte und unerschöpfliche Sichregen der Dinge.
Es birgt ja auch dies Sichregen „Sinn“ nicht nur in seiner rhythmischen Regelmäßigkeit, sondern auch insofern, als es unmittelbarer Ausdruck von etwas ist oder zu sein scheint. Gerade dadurch, daß sich elementare Vorgänge — das Ansteigen und Abflauen des Windes, das Aufglühen und Verdämmern des Lichtes, selber Vorgänge von übergroßem Rhythmus — in den Bewegungen getroffener Dinge [Pg 36] widerspiegeln, gewinnen sie für uns etwas Seelisches. Die Bewegungen in der Natur scheinen, wie jeder Dichter sie ausnutzt, Erregungen in unserm Innern zu entsprechen. Ruhiges Dahinfluten und trotziges Sichaufbäumen, glückseliges Glasten im Sonnenlicht und felsenerschütterndes Aufflammen befreiter Massen — in alledem erblicken wir uns selber wieder. Es sind zuletzt dieselben Rhythmen, in denen Wogen und Herzen schlagen. Die Natur selber ist eine fertige Dichtung — es fehlte uns bisher nur das Handwerkszeug, sie unverfälscht nachzudrucken.
Vor meinem Fenster, wo ich dies schreibe, schiebt sich der Strom dahin. Undurchsichtig und spiegelnd sein Wasser, seine eignen Wellengekräusel wie Eisschollen oder abgerissene Büsche dahintreibend. Drüben das aufsteigende Ufer mit seinen Villen, Straßen und dem Himmel drüber her badete sich in der Wintermittagssonne. Von Zeit zu Zeit hastete ein Straßenbahnwägelchen dahin und ein anderes zurück. Menschen wanderten und stiegen. Der Wind blies kleine Staubwolken auf. Diesseits, im Garten, bogen sich, wogten und wackelten knospendicke kahle Zweige. Das alles war Staffage. Verloren beobachtete es das Auge und kehrte immer wieder, immer wieder zu dem blinkenden Strombande hin. Die lichten Spiegelbilder der Häuser, die zerreißenden Schatten der Waldstämme waren das Bleibende. Die Wellengekräusel, die Blinklichtflöße trieben und trieben vorbei. Immer andere und immer dasselbe. Warum verweilte das Auge so gerne darauf? Warum wurde es nicht satt, das zu sehen? Warum stieg gerade aus diesem Bilde, gerade aus dem Bilde des beständig laufenden Flusses soviel Ruhe, Frieden, innere Heiterkeit ins Herz hinein, während die erregten Punkte und Flecke der Ufer die Unruhe bedeuteten? Und nun trat das Drama der Bewegung ein. Vom Fensterrahmen her schob sich der Bug eines beladenen Lastschiffs her. Sein Körper folgte nach: groß, licht, bunt. An seinen Planken schlängelten sich die Spiegellichter des Stromes. Die Menschen standen regungslos ans Steuer gelehnt. Langsam — oder schnell — so langsam oder so schnell wie das Herz das Strömen des Wassers deutete — schob sich das große Schiff vorbei, und hinterm Fensterrahmen kräuselten sich wieder die kleinen, feinen Wellengeriesel.
Eine halbe Stunde darauf war das Wasser überkämmt von lauter größern, aufstechenden, gleichmäßigen Wellen, alle im Aufbäumen und Versinken gleich schnell vom Strome mit davongetragen. Das kahle Gezweige, das ins Bild hineinragte, schien ängstlicher ineinander zu wirren.
Jetzt teilte sich das Licht. Große Flächen voll warmer Farben — im Bilde würden es Helligkeitsunterschiede sein —leuchteten weit an den Ufern überm Spiegel. Der Tag rüstete sich, Abschied zu nehmen. [Pg 37] Unser Apparat hätte sein Auge sehr groß auftun müssen, um davon noch etwas zu erhaschen, und doch: es wäre gegangen.
Etwas, das sich unsere Aufnahmekünstler ebenfalls weniger entgehen lassen sollten, sind atmosphärische Feinheiten — dasjenige, was der Maler Luftperspektive nennt. Es ist vielfach dasjenige, was ein Bild vermeintlich „undeutlich“ macht, in Wirklichkeit ihm die Schärfe nimmt. Aber diese Schärfe ist ja unwahr und daher unschön, wo sie unwirklich ist. Im Photographieren solcher Feinheiten sind die Engländer am meisten voran; sie haben es von ihren Augenblicksphotographen gelernt. So wie die Engländer die einzigen sind, die künstlerische Naturaufnahmen um ihrer selbst willen als Lichtbilder in größerm Umfange und regelmäßig in den Verkehr bringen (welcher deutsche Lichtbilderkatalog verzeichnete dergleichen?!), so wie die englischen illustrierten Blätter, z. B. Country Life, („Landleben“), Naturaufnahmen zeigen, in denen die schwierigsten atmosphärischen Aufgaben glänzend gelöst sind, so haben sie kinematographische Naturaufnahmen dieser Art, die zum schönsten gehören. Es klingt lächerlich, ist aber wahr, der Silberduft der Seeluft umspielt sichtbar die Strandblumen dieser Bilder; der graue Glanz der Winterluft liegt über diesen Aufnahmen von Eis und Schneelandschaften. Wenn man einem deutschen „Operateur“ mit der Zumutung kommt, vor einem derartigen Gegenstand, bei irgendeiner andern Witterung als „grellem Sonnenschein“, zu irgendeiner andern Stunde als „von 10 bis 4“ seinen Apparat aufzustellen, so kann man sicher sein, mit „fachmännischer“ Entrüstung zurückgewiesen zu werden, weil solche Bilder: a) „technisch unmöglich sind,“ b) „unser Publikum langweilen“. Von beiden weiß aber unser Kinomann gar nichts, weil er: a) niemals die technischen Möglichkeiten versucht hat, b) (wovon ich schon gesprochen), nie ein Publikum vor solchen Bildern gesehen hat, weil es sie — fast nie gibt. Er hält sich dafür an jene berüchtigten „Mondschein“-Bilder, für die der ganze Film dunkelblau, und die „Sonnenuntergangs“-Bilder, für die er dunkelrot gefärbt wird. Wenn aber einerseits jeder gute Geschmack aufhört, wo der Aufnehmende die Grenzen seiner technischen Möglichkeiten wirklich überschreitet (und dann eben Fälschungen obiger Art liefert), so beginnen anderseits die künstlerischen Reize einer Kinoaufnahme eben gerade da, wo der Aufnehmende mit seinen technischen Möglichkeiten zu ringen anfängt. Das ist’s ja gerade, das den Künstler ausmacht, daß er das Unmögliche möglich zu machen, daß er die weichen Formen des Menschenleibes in Stein und Bronze, das rieselnde Spiel von Sonnenlicht und Schatten mit ölvermengten Erden, die zartesten Bewegungsvorgänge mit der Filmschicht festzuhalten sucht. Nebelglanz und Wolkenzug sind aber gerade darum so schön, weil sie leben, weil sie Bewegung sind oder sich an bewegten[Pg 38] Dingen kundgeben. Es ist ja wahr, daß man, um wertvolle Bilder dieser Art zustande zu bringen, manche Studien machen und verwerfen, manches Lehrgeld wird zahlen müssen. Auch der Maler muß ja jahrelang arbeiten und verwerfen, ehe er zu Meisterleistungen gelangt; wenn auch seine Skizzen immer Interesse haben. Und Films sind freilich ein teures Versuchsmaterial. Aber sie bringen ja auch, wenn gelungen, teures Geld ein; und auch hier haben Skizzen, die von ehrenhaftem Bemühen zeugen, ihren Wert. Diese Art Bilder würden ebenfalls neben denen von geschichtlichem und anderm inhaltlichen Werte, um ihrer Schönheit willen, leicht hohen Sammlerwert gewinnen. Kunstmuseen und einzelne Liebhaber würden sich um sie bewerben, Schulen und Vereine sie ihren Schätzen einverleiben. Daneben würden sie durch die Kinotheater wie andere ausgenützt werden.
Wer es in diesen Dingen zur Kunst bringen will, muß beim Maler und beim Augenblicksphotographen in die Schule gehen. Sein eigentlicher Lehrsaal aber ist das Kinotheater: was hier wirkt und wie es wirkt, muß er unablässig studieren. Denn nicht schöne Natur, sondern ein schönes Bilderspiel soll er ja schaffen. Seine unerschöpfliche Fundgrube aber ist die Natur selbst. Darin muß er täglich mehr sehen und ins Kinematographische übersetzen lernen. Feste Regeln zu geben ist natürlich unmöglich, denn hier ist dem persönlichen Geschmack unermeßlicher Spielraum gelassen. Einige Gesichtspunkte aber, die zum Richtigen führen können, wollen wir andeuten. Es handelt sich namentlich um drei Dinge, die wir die Wahl des Motivs, des Ausschnitts und der Komposition nennen wollen. Die drei dem Gebiete der Malerei entnommenen Bezeichnungen gewinnen, auf Kinematographie angewendet, eine etwas veränderte Bedeutung, da eben der Kinematograph etwas zeitlich Fortdauerndes, ein Hintereinander, der Maler aber ein Nebeneinander darstellt.
Das Motiv des Kinokünstlers ist natürlich ein Bewegungsvorgang. Wie die Wahl desselben durch technische Bedingungen begrenzt wird, haben wir schon in einem frühern Abschnitt angedeutet. Im Hinblick auf die Vorführung kann der Aufnehmende aber auch solche Aufnahmen wählen, an denen sich das Mangelnde bei der Wiedergabe durch Wort, Geräuschnachahmung u. a. ergänzen läßt. Nicht ergänzen lassen sich Farbenspiele. Plötzliche Vorgänge können aber für den Beschauer durch den Vortrag vorbereitet werden. Undeutliche Einzelheiten kann ein vorangehendes Lichtbild deutlich machen. Mit Rauschen, Donnern, Explosionen begleitete Bewegungen können zum Teil — wenn sie vereinzelt auftreten und die Geräusche deutlich und einfach sind — mechanisch andeutend in diesem Sinne ergänzt werden. Zarte Geräusche aber — wie Blättersausen — lang dauernde — Meeresbrandung — oder individuelle — Vogelgesang — kommen meist für [Pg 39] Wiedergabe nicht in Betracht. „Waldweben“ als solches ist kein kinematographisches Motiv. Was nicht „al fresco“ im groben, in großen Zügen, wirkt, hat seine Grenzen in der Wiedergabe.
Die Bewegung selber aber, die das „Motiv“ bilden soll, werde nicht auf ihren Umfang oder ihre Heftigkeit, sondern auf ihre innere Schönheit geprüft. Es kommt in Frage, ob der Apparat so weit oder so nahe herangestellt werden kann, daß das, was uns in der lebendigen Wirklichkeit fesselt, im Bilde wieder deutlich sichtbar wird. Es ist ferner zu erwägen, wie lange das Bild wirken muß, damit es allmählich über den Beschauer Macht gewinnt, seine Seele gefangen nimmt, ihm seine feinen Reize enthüllt, ihm die Stimmung bringt. Hiergegen sündigen fast alle derartigen Aufnahmen. Kaum fängt das Auge an, sich in die Pracht zu vertiefen, da springt das Bild um. Der im Stofflichen befangene Aufnehmende glaubt, er müsse den Zuschauern nur ja alle drei oder fünf Sekunden etwas „Neues“ bieten, damit sie sich nicht „langweilen“. Eben darum aber wirken die meisten dieser Bilder langweilig und lösen Unruhe im Publikum aus — weil es ja eben „nichts ist“! Weil das Auge nicht einen einzigen Augenblick Zeit gewinnt, sich zu vertiefen, weil das Bild einem weggezerrt wird, gerade wie man zu „schauen“ beginnen wollte. In den meisten Bewegungen wird man einen wirklichen Rhythmus bemerken, etwas wie das Hin- und Hergehen unzähliger kleiner, vieler mittlerer und weniger größerer Pendel. Diesen Rhythmus muß man erkennen und sich auswirken lassen. Auf großen Wogen schwanken und rieseln zahlreiche kleine, und nach drei oder vier großen Wogen kommt eine riesenhafte, als wolle sie alle vorigen überbieten. Diese größte muß Zeit haben, einige Male zu erscheinen: dadurch kommt der Beschauer hinter die großartige Schönheit dieser Bilder.
Was den „Rahmen“ des Bildes angeht, den „Bildausschnitt“, so muß sich der Kinomann nach andern Gesichtspunkten richten als der Maler. Dieser kann kleine Fehler des wirklichen Bildes ändern, er hat die richtige Augenperspektive, er berücksichtigt die Beweglichkeit des Auges, indem er Vorder- und Hintergrund gleich scharf malt, für ihn sind ganz andere Dinge Hauptsache als für uns. Ein naher Vordergrund, z. B. ein Blick durch eine Baumlücke, oder aus einer Felsenhöhle heraus auf die See, kommt, wenn das Motiv selbst in der Ferne (auf unendlich) liegt, meist unscharf oder dunkel, ohne Einzelheiten heraus. Namentlich im letztern Falle wirkt es, als gehörte es nicht zum Bilde. Wo also Rahmen und Motiv nicht annähernd in eine Ebene zu bringen sind, werden wir auf erstern meist lieber verzichten. Ein ins Bild hinein wischender, überlebensgroßer Zweig z. B. ist nur störend. Wir müssen ihn vorher wegbinden o. dgl. Man muß darauf sehen, daß die das Motiv bildenden — die an einer bestimmten Bewegung[Pg 40] teilhabenden — Gegenstände entweder im ganzen zu übersehen sind, oder aber ein solcher Überblick vom Auge nicht verlangt wird. Habe ich z. B. das oben abgeschnittene Bild eines Wasserfalls, so stört mich das, weil ich im unklaren bin, ob das Wasser vielleicht doppelt so hoch, wie im Bilde sichtbar, oder etwa eben über der abgeschnittenen Stelle herunterfällt. Zeigt man nun aber nur eine kleine Stelle des Falles aus nächster Nähe, so komme ich gar nicht auf den Gedanken, nach der Höhe des ganzen Falles zu fragen. Man muß eine vollständige Bewegungseinheit auf das Bild zu bekommen suchen — d. h. ein „geschlossenes“ Bild, ein Motiv, das die Phantasie befriedigt und nicht Fragen übrig läßt.
Die „Komposition“ in einem Kinobilde bezieht sich auf das Nach-, nicht das Nebeneinander. Sie ist die schwierigste Aufgabe, weil eben hier der Aufnehmende ja wenig „machen“, sondern nur klug auswählen und abpassen kann. Man kann eben nicht, wie jener Operateur, angesichts einer Wüste so lange drehen, bis irgendwoher ein Kamel ins Bild kommt. Trotzdem erhöht es den Reiz eines Bildes ums Vielfache, wenn es auch in dieser Hinsicht Komposition hat, wenn die Bewegung nicht nur episch ist, sondern sich zum Dramatischen steigert. Ein Beispiel davon bot ich in der Schilderung des Stromes von meinem Fenster aus. Zuerst muß der Beschauer Zeit haben, sich in das unscheinbare Spiel von Wellen, Wind, Wolken und Menschlein zu vertiefen. Dann sucht nun das Auge nach Abwechslung, nach einem Gegensatz an diesem Idyll, und den bildet das groß und ruhig auftauchende, durch- und abfahrende Schiff. Wie dramatisch ein solcher scheinbar so nüchterner Vorgang ist, wie er die Phantasie anregt, wissen wir ja aus entsprechenden Laterna-magica-Bildern. Da erscheint zuerst die starre, grobkolorierte Landschaft und dann das ebenso starre hindurchgeschobene Schiff. Das packt uns, weil in der Einfachheit etwas Typisches, ich möchte sagen ein Symbol steckt. Oder man stelle sich ein Stück Waldinneres, einen lauschigen Seitenpfad vor. Das Sonnenlicht spielt in den leise atmenden Blättern. Im Sonnenstrahl tauchen goldene Lichtfünkchen auf, sammeln sich und tanzen auf und ab: die Waldmücken. Das Ballet tritt ab; wir atmen förmlich die Waldesstille. Da erscheint ein Kopf auf schwankem Hals. Ein Reh äugt uns an. Es tritt vor auf den Weg und schaut lange zu uns her. Plötzlich ein Zucken; es springt seitwärts und verschwindet im Gebüsch. Es wäre ein Meisterwerk, nämlich eine große Schwierigkeit, die vielleicht wochenlange Vorarbeit erforderte, das Bild zu erlangen. Aber es würde überall, bei den Feinsten wie bei den Kleinsten ungemessenen Jubel erregen. Wir hätten die Schönheit der Bewegung der Natur in dramatischer Steigerung vom Mückentanz und Blättersäuseln bis zum zierlichen Schritt und jähen Sprung des großen Waldtieres belauscht.
So schwierig eine derartige Komposition mit „lebendiger“ Staffage ist, so leicht ist sie, technisch genommen, reiner Landschaft gegenüber, weil es da ja nur gilt, den richtigen Rhythmus zu belauschen, richtig einzusetzen und wieder aufzuhören und — unvorhergesehene Ereignisse zu vermeiden. Auch kann man ja hier Dramatik ins Gesamtbild bringen, indem man verschiedene Motive aneinanderfügt; z. B. zeigt man das Meer in alltäglichem Wogenatmen. Dann an anderer Stelle und zu anderer Zeit, wenn die weißmähnigen Rosse ungestüm furchend die Hälse aus dem Wasser heben. Nun steigernd das Meer bis zur Sturmbrandung — — und wieder abflauend bis zum regungslosen Blinken.
Den Höhepunkt der Kunst bildet die Komposition solcher Bilder mit Menschen darin. Der Greuel greulichster ist der Mensch in seiner Pose. Jemanden, der’s weiß, dazu verwenden, ist jedem sich achtenden Aufnahmekünstler verboten. Ich ging mal mit einem Maler spazieren und wollte ein bestimmtes Motiv aufnehmen. Ich bat ihn, doch mal „des Weges herzukommen“. Er ging ganz vergnügt weg und kam als ein anderer wieder. Die Brust herausgeworfen, die Augen blitzend, den Hut schief, den Mantel zurückgeschlagen, die Beine als wollt’er Menuett tanzen — ich lachte grimmig und verzichtete. Hübsche Mädchen und Kinder pflegen zu lachen — kurz der Mensch, der sich photographiert weiß, verdirbt jedes Bild.
Übrigens auch jeder, der sich gemalt weiß. Und darum muß es der Kinokünstler wie der Maler machen: er muß den Menschen belauschen. Vielleicht hat er gerade den Apparat vor einem Kornfeld aufgestellt, über das halmbiegend die Wölfe der Mittagshexe rennen. Da kommt ein Schnitter daher, und nach umständlichen Vorbereitungen — sein Selbstgespräch beweist, daß er sich unbelauscht glaubt — beginnt er die Sense zu schwingen. Der sieht uns nicht: aber gierig sucht unser Apparat die Lichtwellen, die von ihm herfluten. So mit tausend Listen und vollem Herzen die ganze Geschichte unsres täglichen Brotes, von der Pflugschar bis zum Frühstück, mit Selbstbeschränkung kinematographisch gezeigt: das könnte ein Kunstwerk werden.
Der Rhythmus der körperlichen Arbeit, der bildet selber ein Stück Schönheit der natürlichen Bewegung. Unermeßlich ist hier das Gebiet des Kinokünstlers. Wenn ich mit diesen Ausführungen erreiche, daß nur in diesem und jenem der Mut geweckt wird, sich überhaupt um diesen Preis zu bewerben, dann soll mir’s genügen. Ein großer Blick für das Leben, seine Echtheiten und seine Schönheiten ist für den Aufnahmekünstler unerläßlich.
Wir haben im bisherigen aus dem Wesen der Kinematographie ihre künstlerischen Gesetze entwickelt. Als Kernpunkt ihres Wesens[Pg 42] erkannten wir ihre Fähigkeit, mit bis dahin nichtgekannten Mitteln neue Seiten der Wirklichkeit im Bilde zu zeigen, im besondern die Schönheit der natürlichen Bewegung zum Gegenstand unseres Studiums zu machen. Als Hauptbedingung, Hauptpflicht betonten wir immer wieder die, diese widergespiegelte Wirklichkeit nicht zu fälschen, sie so aufzunehmen und weiterzugeben, daß sie auf der Leinwand in völlig entsprechenden Verhältnissen wiederkomme. Dies zu erzielen, war die eigentliche Kunst des Kinematographen. Eine hohe und strenge Kunst, die der Willkür des Ausübenden scheinbar sehr enge Grenzen setzt, die sich an eine enge Gruppe von Empfindungen wendet, eine Augenkunst recht eigentlich. Eine feine Kunst auch, die zu ihrer Wirkung der Sammlung und Vorbereitung, der mittätigen Phantasie, geschulter Sinne und guten Geschmacks bedarf. Und eine mühsame Kunst, deren Werke nur das Ergebnis einer langen Reihe, aus verschiedenen Händen hervorgegangener oft kostspieliger, sorgfältiger Arbeiten sind. Eine Kunst endlich, die zu ihrem höchsten Erfolge eine langsame Gesamtentwicklung erfordert.
Kein Wunder, daß eine solche zwar tiefster, aber mühsam heraufzuholender Wirkungen fähige Kunst dem Heere derer, die von der Kinematographie in erster Linie einen reichen, aber mühelosen Gewinn erwarteten, ohne sich im geringsten um das seelische Wohlbefinden derer zu beunruhigen, die ihnen das Geld herbeitragen sollten — kein Wunder, sage ich, daß denen diese Kunst viel zu langsam ging. „Die Kinematographie selbst zur Höhe einer Kunst zu erheben“, das versuchten sie gar nicht erst. Statt dessen verkuppelten sie die mit einer andern, an sich hohen Kunst, der des Schauspiels. Sie erniedrigten beides, Schauspielkunst und Kinematographie, und brachten dadurch jenen Wechselbalg zustande, der als „Kinodrama“ seine Erfolge unseligen Andenkens gefeiert hat. Der tatkräftige Widerspruch, den diese Schande der Zeit bei den wahren Freunden und Erziehern des Volkes so gut wie bei denen der Theaterkunst und der echten Kinematographie fand, hat, scheint es, den Erfolg gehabt, den Stachel nur immer tiefer ins Fleisch zu treiben, statt ihn zum Ausfallen zu bringen. Mit dem steigenden Widerspruch der Gegner stieg der Reklameaufwand der Filmfirmen, mit denen sie ihre Erzeugnisse erst recht als „höchste Kunst“, „films d’art“, „dramatische Meisterwerke“, „künstlerische Volkserziehung“, das Kinotheater als das „Theater des kleinen Mannes“ anpriesen. Je widerwärtiger die Bilder inhaltlich wurden, desto lauter schrien die Ankündigungen: „Erzieherisch! Dezent! Für Kinder freigegeben!“, und je entschiedener sie sich ihrem ganzen Wesen nach von dem der dramatischen wie der Kinokunst entfernten, mit desto raffiniertern Mitteln — zuletzt unter genauer Nachahmung aller für Theateraufführungen[Pg 43] üblichen Ankündigungsformen, wie „Erstaufführung für X. reserviert“, „A. N. in der Titelrolle“ mit Personenverzeichnissen usw. — wurde die Täuschung unterstrichen. Es sind geradezu gigantische Anstrengungen von den großen Firmen gemacht worden, es sind besonders riesige Kapitalien — Hunderttausende von Franken — in die Herstellung dieser, der Sensation einer einzigen Woche dienenden, dann von ihren Urhebern selbst zur Vergessenheit verurteilten Nichtigkeiten, Albernheiten und Geschmacklosigkeiten verpufft worden. Zugleich aber, wenn auch äußerst langsam und widerstrebend, wurden so wenigstens einzelne Firmen auf einen Weg gedrängt, der doch endlich so oder so zu einer Besserung führen muß. Es ist zwar heute noch nicht viel mehr als Reklame, auf die man nicht viel geben darf, wenn neben den Namen vereinzelter wirklich bedeutender, d. h. auch als Kulturerscheinung bedeutender Schauspieler und Schauspielerinnen auch solche von Dichtern als künftiger Film-„Text“-Verfasser auftauchen, von denen wir doch — wie von Gerhard Hauptmann — wissen, daß sie endlich ihrer Natur nach gar nicht anders können, als auch auf diesem Gebiete, wenn sie sich dort einmal betätigen, zum Gediegenen und in irgendeinem Sinne auch künstlerisch zu Rechtfertigenden zurückkehren. Hoffen wir nur, daß gerade diese Entscheidenden erstens auch wirklich zum Schaffen kommen, nicht nur ihre Namen als „Anreißer“ in Rundschreiben und Zeitungsnotizen prunken, und daß sie zweitens Vorsicht, Rückgrat und — Handwerk genug wahren, um sich nicht übertölpeln zu lassen. Sonst können sie erleben, eines Tages auf der Leinwand unter ihrem Namen „Dramen“ erscheinen zu sehen, die ihnen die Röte ins Gesicht treiben. Mögen sie vor allem nicht vergessen, daß auf diesem Gebiete mit dem Textbuche nichts getan ist. Der eigentliche „Kinodichter“ ist der, der die Regie hat — und seiner harren Aufgaben, die schwieriger sind als manchmal die des Bühnenregisseurs. Denn er soll neue Wege pflügen, wo der andere Überlieferung, Schule und Vorbild vorfindet.
Die Frage „Kino und Bühne“ — die übrigens mehr Seiten als die hier angedeutete hat — ist in einem andern Bändchen dieser Sammlung behandelt worden. Ich sehe daher hier von allem ab, was sie besonders betrifft, und beschränke mich darauf, auf meinem eignen Wege fortschreitend, die Frage des „gestellten“ Kinobildes und seiner Erhebung zu einem Kunstwerk überhaupt und ganz allgemein zu behandeln.
Wir können ja nicht leugnen, daß der Kinematograph, wenn auch sein Eigenruhm die Wiedergabe unbefangener und unbewußter Wirklichkeit ist, doch fähig ist, auch Bilder zu erzeugen, die von denen der Wirklichkeit abweichen. Auch diese Bilder haben zweifellos [Pg 44] ihren Reiz, und eben dadurch tritt auch für sie die Forderung auf, sie, wenn überhaupt, zu Kunstwerken zu machen. Solche Bilder können entstehen, indem wir entweder an Stelle natürlicher Gegenstände menschliche Arrangements, vor allem also menschliche Pantomimen aufnehmen, oder indem wir natürliche Vorgänge durch eine besondere Art von Aufnahmen ganz verändert und in nicht mehr natürlicher Weise auf der Leinwand erscheinen lassen.
Bilder letzterer Art werden „Trickszenen“ genannt, und es kommen da eine ganze Menge von „Tricks“ in Betracht. Der häufigste ist die zu schnelle oder zu langsame Aufnahme eines Vorgangs, wodurch dieser umgekehrt entstellt im Bilde widerscheint. Wenn ich z. B. vor einem laufenden Automobil die Aufnahmekurbel zu langsam drehe, das fertige Bild aber im gewöhnlichen Zeitmaß abrolle, so läuft das Bildautomobil mit einer ganz unmöglichen Schnelligkeit. Das wirkt natürlich sehr lustig, wenn man’s nicht zu oft sieht. Umgekehrt kann ich von einem langsamen Vorgange — z. B. dem Erblühen einer Blume — Einzelaufnahmen in langen Abständen machen, die bei gewöhnlicher Vorführung dann ein beschleunigtes Bild des Vorgangs geben. Zu solchem Zwecke angewendet — d. h. wenn das wahre Verhältnis nicht, wie oben, verschleiert wird — handelt es sich um eine vollkommen „richtige“ und oft lehrreiche Naturaufnahme. Wird aber ein derartiges Bild beispielsweise in ein anderes, im gewöhnlichen Zeitmaß aufgenommenes hineinkomponiert, so daß es z. B. so aussieht, als blühe die Blume auf, während gleichzeitig ein Mensch eine beschwörende Gebärde macht, dann wirkt das Bild märchen- oder zauberhaft. Wird, wie man es häufig erlebt, ein Wasserfall oder eine Eisenbahnfahrt durch eine Landschaft in so beschleunigter Weise vorgeführt (damit das Programm eher zu Ende ist), so ist das durchaus unkünstlerisch. Wird es aber absichtlich zu Zwecken der Illusion, zur Erregung von Heiterkeit oder Märchenstaunen gebracht, so kann sich eine ganz hübsche, unter Umständen auch künstlerisch einwandfreie Unterhaltung daraus ergeben.
So betrachtet, sind wir geradezu wieder einem Wirkungsmittel auf die Spur gekommen, das nur das Kino in gleicher Vollendung besitzt: die Einflechtung zauberhaft erscheinender, durchaus wirklichkeitsfremder Szenen und Übergänge in ein im übrigen alle Kennzeichen höchster Naturwirklichkeit tragendes, ja sie verbürgendes Bild. Besonders das Ineinanderkomponieren zweier in Wirklichkeit getrennt aufgenommener Bilder bietet da eine Fülle reizvoller Möglichkeiten: fingergliedgroße Zwerge tanzen unter Menschen, Visionen erscheinen und verschwinden, ein Gulliverautomobil fährt durch Zwergenstädte usw. Ein geschmackvoller Kinodichter wird bei der[Pg 45] Wahl seiner Stoffe und in der Art ihrer Behandlung nicht von den Möglichkeiten und Vollkommenheiten der Schaubühne, sondern von denen der Kinoleinwand ausgehen. Er wird im Berührten sofort — wie es ja viele getan haben — die Anregung finden, für das Kinoschauspiel zunächst an Stoffe zu denken, deren Wirkung auf dem Ineinanderflechten von Wirklichkeit und Unwirklichkeit besteht. Vor allem also Märchen und Zauberpossen! Das Märchen vom Tischlein deck dich wäre so recht ein Kinomärchen. Aber wichtiger, als anzuregen, ist es hier zu warnen. Denn es haben schon viele für das Kino-„Märchen“ bearbeitet, und fast alle diese Märchen sind — Greuel geworden. Das lag und liegt vor allem daran, daß nichts schwieriger ist, als im Bilde gerade den guten Übergang vom „Wirklichen“ zum „Unwirklichen“ zu finden. Unserer Märchen Reiz und Wert liegt gerade in dem fortwährenden, unmerklichen, unabgrenzbaren, im Kunstmärchen — schon verschlechtert — mehr oder minder „traumhaften“ Ineinanderspielen von beidem. Diese Zauberereignisse sind nicht zauberhaft. Wie auch in der Götter- und Heldensage spielen sich auch die über- und unternatürlichen Vorgänge in Verhältnissen und Übergängen ab, die beides, Natur- und Geisterwelt „organisch richtig“ erscheinen lassen. Gerade diese Fähigkeit fehlt aber dem Kinematographen. Natürliches und „Zauberhaftes“ stehen schroff nebeneinander. Die „Geister“ sind nur kleiner oder größer, ferner oder näher, vielleicht auch durchsichtig; im übrigen aber haben sie nichts Geisterhaftes, sondern sind Menschen mit zu scharfen Umrissen, zu harten Einzelheiten, zu menschlichen Größenverhältnissen. Die Masken, Schleier und Maschinen, die auf der Bühne so ganz anders wirken können, erscheinen hier brutal wieder als Masken, Schleier und Maschinen. Und ebenso ist es mit dem Einsetzen und Vergehen derartiger Visionen. In die lebendige Natur hängt plötzlich etwas Künstliches hinein, und das ist immer häßlich. Hier muß die Regiekunst vereint mit der Technik äußerste Anstrengungen machen. Der Kinodichter aber erwarte nicht, hier „traumhafte“ Wirkungen, überhaupt nichts „Zartes“ verwirklichen zu können. Vielmehr ergibt sich für ihn ein harter, etwas eckiger, hölzerner Stil, wie er sich auch für das Kasperle und das mechanische Theater herausgebildet hat, etwas wie eine ruckweise Stilisierung der Vorgänge. Das hat ja auch seinen eignen, ich möchte sagen humoristisch-melancholischen Reiz. Das Material — der Film — nimmt gewissermaßen die lebendigen Gebärden mit sich, übersetzt sie in seine eigne Sprache ruckweiser und ungelenker Fortbewegung. Die vom Dichter hineinzutragende Stilisierung ist vielleicht das Vermittelnde zwischen der im „gestellten“ Bild schroff nebeneinanderstehenden Natur und Unnatur.
Diese tritt noch in etwas anderm zutage: in dem nicht zu überbrückenden Gegensatz zwischen dem Naturmilieu und den sich darin bewegenden Schauspielern. Dem kann man natürlich entgehen, indem man die Szene in ein Kulissen-Interieur verlegt. Hier wirkt das Unnatürliche weniger störend, weil eben alles Unnatur ist. Auf der andern Seite liegt aber eben wieder in dieser Möglichkeit, wirkliche und angestrebte Natur — Natur und Mimik in einem Bilde zu vereinen, ein neuer Reiz und damit eine neue, eigne Quelle künstlerischer Wirkungen für den Kinodichter. In dieser Hinsicht „kann“ der Kinematograph zweifellos wieder mehr als etwa die wirkliche „Naturbühne“. Denn deren Wirkung, ja bloßes Dasein ist an eine Menge selten zusammentreffender Bedingungen geknüpft, und die Illusionsstörungen sind bis zur Unüberwindlichkeit groß. Ja, da, wo das Drama doch endlich seinen Höhepunkt hat, beim gesprochenen Wort, wird die natürliche Umgebung geradezu überflüssig, daher stilwidrig. Der Kinematograph hat da manches voraus. Aber auch hier ist der genannte Gegensatz kaum zu überbrücken. Vielmehr scheint alles mehr darauf hinzuweisen, Natur und Spiel mehr hinter- als nebeneinander wirken zu lassen. So wie wir innere und Naturvorgänge gern dichterisch vergleichen und eins durch das andere illustrieren, so würde gewiß zwischen zwei pantomimischen Szenen unter Umständen ein reines Naturschauspiel wunderbar stimmungbannend wirken. Denken wir uns so aus einem „Liede vom Meer“ eine Szenenfolge; nach langem, innern Kampfe hat die Frau den Liebenden in die Welt fahren lassen. Wir lassen ihre sinnend zusammengesunkene Gestalt im Zimmer, in das sich die Dunkelheit senkt. Das Bild wechselt nach kurzer Pause, und wir sehen am Strande, wo sie in einer frühern Szene mit dem Geliebten gewandelt ist, die Wogen des Meeres unruhig heranbrausen und zurückfallen, ohne daß eine Figur mit dramatischer Pose die Sprache der Natur stört.
Vergebens oder vielmehr enttäuschend hat sich bisher die naheliegende Hoffnung gezeigt, daß die Kinematographie vielleicht die Erweckerin einer neuen, in sich reifen mimischen Kunst werden würde. Gewiß, es haben sich viele Schauspieler gefunden, die ihre Gebärdensprache erfolgreich in den Dienst des Kinos gestellt haben. Aber wohl alle (mir ist wenigstens keine Ausnahme begegnet) haben mehr oder minder nur die übliche Bühnengebärden- und -mienensprache dem Kino angepaßt. Sie haben sich vor allem auf diejenige auf der Bühne übliche Mimik beschränkt, die im Kinobilde überhaupt zur Geltung kommt — und das sind nur die übertriebenen, heftigen, fratzenhaften Begleitgebärden zu Worten. Da aber das Kinoschauspiel keine Worte kennt, so würden die meisten dieser Gebärden unverständlich bleiben, wenn nicht ein sogenannter „Rezitator“ oder[Pg 47] „Humorist“ — die Erklärung dazu verläse. Da diese Erklärung weder an sich künstlerisch erträglich ist, noch mit der photographierten Mimik zu einem Ganzen verschmilzt, so bleibt das Ganze eine Geschmacksungeheuerlichkeit. Wer für das Kinobild spielt, kann das als Künstler nur tun, indem er eine für sich sprechende, stumm-deutliche Gebärden„sprache“ erfindet und sich auf das beschränkt, was sich mit Gebärden aussprechen läßt. Da im Bilde ja noch von der wirklichen Mimik vieles verloren geht, so ist der Kinoschauspieler in der Tat auf einen geringen Formenschatz angewiesen, und auch von diesem Gesichtspunkte her empfiehlt sich der Ausweg einer mechanikartigen Stilisierung und einer mit wenigen übereingekommenen Handgebärden al fresco wirkenden Körpersprache. Da, wie schon bemerkt, dem Kinobilde Plastik und richtige Perspektive fehlen, so empfiehlt sich hier vielleicht die Komposition in ein flaches Bühnenbild hinein. Alles dies muß auch der Kinodichter berücksichtigen. Worte dürfen auf keinen Fall die Gebärde stören, weder als „Erläuterungen“ noch als „Dialog“. Zwischen Worten und Bildgebärden ist so wenig Übergang wie zwischen Naturmilieu und Mimik oder Wirklichkeit und „Traum“ im Kinobilde. Sollen Worte mitwirken, so müssen sie zwischen die Bilder verlegt werden. Vielleicht kann man auch wagen, einzelne Motive nach Art lebender Bilder durch erläuternde Verse begleiten zu lassen, doch kann das nur zur Verdeckung minderwertigen Spieles geschehen.
Jene Eigenfähigkeit des Kinos aber, Natur und Spiel räumlich und mit gleicher Realistik zu vereinigen, weist wieder auf ein besonderes Gebiet hin, wo es Meister sein könnte: die pantomimische Wiederherstellung geschichtlicher Vorgänge auf natürlichem Schauplatz. Zweifellos würden solche Vorgänge in dramatische Form gebracht werden. Ihr eigentlicher Wert wäre aber nicht der dramatische, sondern der archäologisch-geschichtliche. Es hat nicht nur Neugierreiz, sondern einen die Phantasie berichtigenden, das Wirklichkeitsgefühl besonders für geschichtliche und kulturgeschichtliche Verhältnisse stärkenden Wert, Menschen und Szenen der Vergangenheit mal nicht in der Verzerrung durch Maler und Dichter, sondern sozusagen „in natura“, in ihrem natürlichen Verhältnis und ihrer natürlichen Wirkung wiedererstehen zu sehen. Natürlich hätte bei solchen Dingen der Gelehrte mehr als der Dichter mitzusprechen, denn höchste, dem Stand unserer Erkenntnis entsprechende Echtheit wäre ja hier die Hauptforderung. Ich brauche nicht besonders zu betonen, daß ich mit dieser Anregung nicht Schrecken wie die Verkinematisierung Homers, Dantes oder Schillers wieder heraufbeschwören oder beschönigen will.
Vielmehr ist eine der wichtigsten Tugenden, die dem mimenden [Pg 48] Kinematographen anzuempfehlen ist, Ehrfurcht und abermals scheue Ehrfurcht vor allen geistigen Höhenleistungen, die er durch plumpes Mitmachenwollen so leicht verballhornen kann. Wo er sich an Märchen, geschichtliche, religiöse oder dergleichen Szenen wagt, zittere er davor, etwas von dem zarten Duft, der geistigen Bedeutung und Größe dieser Dinge anzutasten. Er wähle nur Szenen, die Realismus, Drastik und puppenhafte Stilisierung vertragen. Es ist seine Eigenart, mit Dingen, die auf der Bühne illusionfördernd wirken, wie Schminke, Kostüme, Maschinen und Posen, illusionzerstörend bis zur Lächerlichkeit zu wirken. Besonders mache ich aber auf die Darstellung religiöser Szenen aufmerksam. Es ist nicht zu leugnen, und besonders von katholischer Seite begriffen worden, daß die kinematographische Vorführung, z. B. von „Szenen aus dem Leben Jesu“, namentlich zu Festzeiten und besonders auf illusionsfrische Zuschauer von oft erschütternder Wirkung ist. Zu dem eigentümlichen Reiz der Schilderung, der ja auch in gewissen Volksspielen mitwirkt, tritt hier der Eindruck der verblüffenden, so selbstverständlich erscheinenden Einfügung von Dingen erlesenster Seltenheit in eine vollkommen natürliche und vertraute Umgebung. Sogar manche ungeschickte, manche unzulängliche Mimik verwischt ja gar der Kinematograph. Aber dann kann eine einzige Unzulänglichkeit, eine einzige Geschmack- und Taktlosigkeit alles wieder verderben. So wirkt ein grobgemalter Papierstern über der Hütte von Bethlehem ebenso abstoßend, wie das plötzliche Hochheben eines nackten Säuglings aus der Krippe unästhetisch, illusionstörend und pietätlos. Mit weniger als den Summen, die an derartige Bilder gewagt werden, ließe sich viel Edleres und künstlerisch Wertvolleres schaffen, als was man gewöhnlich zu sehen bekommt.
Versucht man, sich weiter in oben entwickeltem Sinne auszumalen, in welcher Richtung die echte Kinopantomime ihre Entwicklung suchen könnte, so kommt man von selber auf den Gedanken an den Kunst- und Ausdruckstanz. Dieser bildet um so mehr eine dankbare Aufgabe für das Kino, als ja auch geschmackvoller Musikbegleitung bei der Vorführung nichts im Wege steht. Doch steht auch hier am Ende drohend und warnend das Schreckgespenst des sogenannten „Tonbildes“, soll heißen der Verbindung von Kinematographie und Phonographie. Diese ist gewiß eine Sache der Zukunft. Aber solange noch Bild und Musik (Rede) getrennt aufgenommen werden müssen, und die Tonwiedergabe nicht von jenem quakenden Nebengeräusch zu befreien ist, kommen diese Tonbilder künstlerisch nur so weit in Betracht, wie es sich um derbe oder humoristische Wirkungen handelt, und auch da nur ausnahmsweise.
Der Humor aber ist ein unbestrittenes Sondergebiet des [Pg 49] Kinematographen. Wir mögen ihn um so weniger missen, als die Kinovorführung an sich ein spröder Gegenstand ist. Was wir aber sehr gern missen würden, sind all diejenigen Szenen, deren Humor stofflicher Natur ist: Fratzenziehen, sinnlose „Verfolgungen“, dumme, freche oder widerwärtige Streiche. Humor ist nicht Lachkitzel, sondern Lustigkeitserregung. Der Humor besteht nicht in zerbrochenen Töpfen oder ins Wasser gefallenen Menschen,— in Anblicken, die augenblicklich lachenerregend wirken — sondern in heitern Gedanken und über Erdenschwere emporhebenden Empfindungen, die in uns erregt werden. Ich rege die Vermenschlichung der Kinoposse an; man bringe Begriffe hinein. Das Kasperle- und Puppentheater bieten hier Anregung und Vorbild. Man zeige uns nicht Narren, Gecken und Krüppel, denen etwas Unerwartetes passiert, sondern lustige Menschen, die Spaß „machen“. Man gebe der Pantomime humoristischen Stil. Und vergesse vor allem nicht, daß in fortwährenden „Lachsalven“, in „toller Heiterkeit“ in einem ununterbrochenen Fortissimo von Knalleffekten jeder feinere Humor zugrunde geht, unbemerkt und wirkungslos bleibt. Guter Kinohumor wird überhaupt nicht eher eine Statt finden, als bis — die übliche Programmgestaltung Raum und Aufnahmefähigkeit für ihn überläßt. Dieser Frage wenden wir uns nun zu.
Alle Anregungen, die wir bisher — statt irgendwelcher fester Vorschriften — geben konnten, dienten nur dem Zwecke, den hauptsächlichen Rohbestandteil kinematographischer Aufführungen, die Filme, auf eine solche Höhe zu erheben, daß sich überhaupt auf ihnen künstlerisch annehmbare Aufführungen aufbauen ließen. Um das noch einmal in einem Satze zusammenzufassen: wir forderten im Grunde nichts, als daß erstens jeder einzelne Film in der größten Vollendung, der er sachlich fähig sei, hergestellt und behandelt werde, und daß dies zweitens stets im Hinblick auf die Gesamtvorstellung geschehen solle, in der er einst zu wirken hat, daß die Wirkung in dieser Gesamtvorstellung den Maßstab der anzustrebenden Vollkommenheit bilden solle. So wie also der Dichter eines Dramas z. B. nicht daran denke, wie hübsch sich etwa sein Werk am Kaffeetisch lesen lasse, oder wie geschmeichelt sich etwa ein Gönner oder eine Schöne dadurch finden werde,— sondern wie er immer nur das Bühnenbild als Erstrebenswertes vor seinem geistigen Auge stehen hat, so soll auch der Kinokünstler beispielsweise nicht daran denken, wie interessant oder schön an sich ein Vorgang sei, oder welches Aufsehen sein[Pg 50] Titel in Zeitungsnotizen machen werde, oder wie belehrend oder moralisch sein Gegenstand an sich sei, sondern nur, ob und wieweit er all diese lobenswerten Eigenschaften haben werde, wenn er als Bild, im Rahmen einer Kinovorstellung unmittelbar zu dem Publikum sprechen werde, das dort in Betracht komme. Wir müssen uns daher nun genaue Rechenschaft davon zu geben suchen, erstens wie eine solche Kinovorstellung notwendig ist, d. h. welches ihre bleibenden und unabänderlichen Bedingungen sind, die also auch für den Filmhersteller Gebote sind — zweitens was nun zu geschehen übrig bleibt, um aus dem gegebenen Stoff, eben einer „Kinovorstellung“ ein harmonisch wirkendes, echtes Gesamtkunstwerk zu machen.
Die Bedingungen einer Kinovorstellung sind infolge der technischen und wirtschaftlichen, zum Teil auch sozialen Verhältnisse, die ihnen zugrunde liegen, enger und unverrückbarer als die mancher andern Kunst. Sowohl Theater wie Lichtbildervorträge lassen sich in den mannigfaltigsten Formen und Zusammenstellungen denken, Kinovorstellungen aber werden stets in erster Linie Massenveranstaltungen sein. Das kommt daher, daß ihr Stoff — besonders die Filme — selber sehr kostspielig herzustellen ist, auch die Vorrichtungen zur Vorführung usw. ziemlichen Aufwand erfordern, während gleichzeitig die Darbietungen doch einer Art angehören und so massenhaft auftreten und auftreten müssen, daß der einzelne im allgemeinen nur geringe Preise dafür zahlen wird. Die Vorführungen lohnen sich also — und zwar je vollkommener sie sind, desto mehr — immer nur, wenn sie vor großen Versammlungen und regelmäßig stattfinden — und eben dies ist wieder ein Grund, weswegen es vergebliche Liebesmüh ist, diesen Darbietungen einen „exklusiven“, künstlerisch oder sozial „vornehmen“ Charakter geben zu wollen. Mag auch das „beste“ Publikum in Kinotheater oder Einzelvorstellungen gehen und in ersterm Stammpublikum werden, und mögen ihm auch die gediegensten Genüsse geboten werden: immer ist doch das Kinotheater wirtschaftlich darauf angewiesen, den geistigen Stand „jedermanns“ zu berücksichtigen, d. h. „voraussetzungslos“ zu wirken. Das bedeutet: es muß im besten Sinne volkstümlich sein. Besonders ist es durchaus zu verneinen, daß die Kinematographie ernstlich entweder literarischen oder (anders als ausnahmsweise) wissenschaftlichen Zwecken dienen kann. Über den erstern Punkt haben wir uns schon im Kapitel von den „gestellten Bildern“ ausgelassen. Das Kinobild, und also die Kinovorstellung kann und wird, gerade je künstlerisch wertvoller es gestaltet ist, im dramatischen Sinne nur eine neue Art von Jahrmarkts-, Puppen- oder mechanischem Theater, eine unter Umständen sehr reizvolle neue volkstümliche Belustigung schaffen, nie[Pg 51] aber etwas, das „literarische“ Ansprüche oder die des Schaubühnenfreundes befriedigte. Soweit aber die Kinematographie wissenschaftliche Hilfsarbeit leistet (im wirklichen Sinne des Wortes) kommt sie als Schaustück kaum, jedenfalls wirtschaftlich nicht in Betracht. Denn „wissenschaftlich“ sind ihre Leistungen nur da, wo sie wie ein neues, die Sinne übertreffendes Beobachtungsinstrument wirkt, z. B. als Ultramikroskop oder zur Zerlegung schneller Bewegungen usw. in ihre Einzelteile. In diesem Falle interessieren den Forscher ihre Einzelbilder in langsamer Betrachtung meist mehr als deren eigentliche kinematographische Vorführung. Das zur finanziellen Rentabilität nötige Publikum finden solche Bilder naturgemäß nicht; sie kommen für „Kinovorstellungen“ als solche nicht in Betracht.
Wo kinematographische Bilder als „wissenschaftlich“ gepriesen werden, sind sie meistens etwas ganz anderes, nämlich „lehrreich“. Natürlich können nur Bilder lehrreich, zu Lehrzwecken brauchbar sein, die mit der Wissenschaft, d. h. Betrachtungsweise und Methode, nicht im Widerspruch stehen, und in diesem Sinne sind sie ja auch „wissenschaftlich“. Solche Filme aber, die wir lieber „Lehrfilme“ nennen wollen, bedürfen eben zu ihrer „wissenschaftlichen“, d. h. unmißverständlichen Vorführung derselben Behandlung wie alle andern. Sie müssen „künstlerisch vollendet“ dargeboten werden, einerlei, ob sie vor Schulkindern, Studenten oder gemischter Zuhörerschaft erscheinen sollen. Auch die wissenschaftlich vorbereitetern Beschauer müssen ja in der Lage sein, diese Bilder erst wieder gleichsam aus dem Kinematographischen ins „Augenrichtige“ zu übersetzen. Auch ihre Phantasie muß richtig eingestellt und geleitet werden: aus der „Vorführung“ muß eine „Vorstellung“ gemacht werden. Auch wenn wir — wohl mit Recht — annehmen, daß zu den heute üblichen Kino- und Saalvorstellungen sich als neuer mächtiger Zweig der Kinematographie Unterrichtsvorstellungen, vielleicht in den Schulen selber, gesellen werden; so unterliegen diese den gleichen technischen, wirtschaftlichen und sozialen Bedingungen. Ja erst deren vollkommene Berücksichtigung durch eine vollendet ausgebildete Vortragskunst wird dem Kinematographen den bisher vergeblich erstrebten Eingang in die Schulen öffnen.
Aus der so bedingten Eigenart aller Kinovorstellungen ergeben sich vor allem eine Anzahl Forderungen, die wir als gesundheitliche zusammenfassen können, deren Berücksichtigung das ästhetische Bild einer Kinovorführung beeinflußt. Von diesen werden wir zum Teil später sprechen; zunächst überlegen wir uns, welchen Einfluß sie auf die Gliederung der Vorstellung, die Programmgestaltung haben werden.
Ein kinematographisches Bild allein und ganz für sich betrachtet, [Pg 52] oder auch eine ununterbrochene Reihe davon ist in jeder Hinsicht ein Unding — ist überhaupt nichts. Es dürfte kaum einen Film geben, der, so vorgeführt, überhaupt inhaltlich verständlich, geschweige denn ästhetisch erträglich wäre. Ein Film gibt, wie schon öfter erwähnt, rein technisch genommen weder ein Bild der Wirklichkeit, noch gibt er, was er gibt, optisch vollkommen. Selbst das beste Kinobild greift anfangs und wieder auf die Dauer die Augen stark an. Das liegt nicht nur daran, daß die Augen durch Überbrückung der Tausende von wirklichen Bildunterbrechungen, die wir als „Flimmern“ stets wahrnehmen (kein Kinobild ist vollkommen flimmerfrei), viel stärker als von einem Bilde mit stetiger Bewegung in Anspruch genommen werden. Sie strengen sich auch unbewußt gleichsam fortwährend an, zu entdecken, was sie in der Wirklichkeit zu finden gewohnt sind. Farbe, Plastik, richtige Linien und deutliche Luftperspektive. Sie kämpfen fortwährend gegen die unscharfen und unerkennbaren, gleichsam unentzifferbaren Einzelheiten, auf die wir vor der Wirklichkeit unser hin und her wandelndes Auge „fixieren“ — was hier nichts hilft. Auch das helle Licht der Natur entbehrt das Auge; hier geht ja alles gleichsam in einem Schattenreiche mit arg gedämpften und gleichsam totem, kreidigem Lichte vor sich. Die Natur selber erläutert uns, was wir sehen, zugleich durch eine Menge von Geräuschen und Klängen, Düften und Berührungen. All dies Fehlende vermißt gleichsam die Phantasie des Kinobesuchers, und die allein von allen Sinnen gebrauchten Augen bemühen sich vergebens, es ihr zu ersetzen. An ihre Stelle muß das Denken treten. So kommt es aber, daß beides, Augen und Hirn vor dem Kinobilde bald erlahmen und das um so eher, je weniger sie vor dem Kinobilde durch andere Mittel unterstützt und ausgeruht werden.
Aus dem Gesagten ergibt sich ohne weiteres, daß es eine künstlerische Anforderung an die Kinovorstellung ist, den Beschauern im weitest möglichem Maße das Fehlende zu ersetzen. Seine Grenze findet dies Bestreben wieder nur in dem Gebote, den Vorzug des Kinobildes, seine automatische Naturechtheit, nicht zu zerstören. Dies geschieht überhaupt nicht durch Erläuterungen usw., die offenkundig gar nicht den Anspruch machen, selber unmittelbare Naturkundgebungen zu sein, und ebensowenig durch technische Ergänzungen, die, wenn auch nicht auf automatischer Naturwiedergabe beruhend, doch Naturgeräusche usw. echt oder stilisiert wiedergeben. Denn durch das letztere Mittel werden sie ja auch wieder als das gekennzeichnet, was sie sind: menschliche, nicht naturautomatische Erzeugnisse, die zwar hinter der Wirklichkeit zurückbleiben (sie nur andeuten), aber auch nicht über sie hinausgehen. Nur das letztere ist geschmacklos.
Diese Hilfsmittel der Kinovorstellung müssen sich gleichzeitig in der andern Richtung bewegen, neben der Erhöhung des Verständnisses der Kinobilder auch dem Ausruhen der Augen zwischen ihnen zu dienen. Zum letztern Zwecke dienen in erster Linie die Pausen zwischen den einzelnen Bildern. Es ist unerträglich, ein Bild nach dem andern herunterhasten zu sehen, womöglich wie ein Negerdorftanz begleitet gleichzeitig von ununterbrochenem Klavierhämmern, Grammophonquarren, Erläuterungsgeschrei und Spässen. Und zwar müssen nicht nur die einzelnen Bilder, sondern auch die Szenen, aus denen sie zusammengesetzt sind, durch deutliche Pausen, in denen Auge und Hirn sich erholen, getrennt sein. Zu diesem Zwecke muß sich zwischen je zwei Filmteilen, wie schon erwähnt, ein Stück grauer oder einfarbiger Film befinden, mit dessen Eintreten ins Gesichtsfeld sofort ein ruhiges, wohltuendes Licht auf der Leinwand ist; hierauf kann die Objektivklappe ganz herabgelassen werden, worauf das neue Bild „fertig“ und schon im Rollen wieder auf der Leinwand erscheint. Eine gute Augenerholung bilden auch an sich schon Lichtbilder, wenn sie deutlich und schön sind. Besonders aber sehnt sich nach langem Grau in Grau das Auge wieder nach Farben, ja nach etwas ganz anderm als dem Erlebten. Aus diesem Grunde ist’s, weswegen ich wiederholt geradezu empfohlen habe, als kurze Programmteile mit vor- und nachheriger Pause kaleidoskopartige Farbenspiele, farbige Nebelbilder, Schattenspiele und andere anmutige optische Scherze und Experimente einzulegen. Jedenfalls wären derartige „Pausenausfüllungen“ weit mehr zu empfehlen als die üblichen meist scheußlichen Lichtbilderreklamen. Auf jeden Fall aber müssen außerdem von Zeit zu Zeit größere Pausen im erhellten Raume eintreten. Auch dieser aber sollte nur am Anfang und am Schlusse voll erleuchtet und allmählich verdunkelt oder erhellt werden. Während der Vorstellung als Ganzem aber vermeide man auch hierin alle grellen Gegensätze. Man halte den Saal während des Spieles so hell, während der Pausen so halbdunkel, wie es mit dem jeweiligen Zwecke zu vereinigen ist.
Ebenso der Augen- und Nervenerholung wie der Ergänzung der Filme dienen die durch Vortrag und Lichtbilder hervorgerufenen Pausen.
Die Begleitgeräusche und die Begleitmusik. Sie entlasten die Nerven und die Phantasie von einer geradezu übermenschlichen Arbeit, regen die Stimmung an, stellen die Übergänge her, schließen Irrtümer und Täuschungen aus, schaffen Abwechslung und Gegensätze. Wer die Dinge einigermaßen eindringend beurteilt, wird uns zugeben, daß eine Filmvorführung an sich überhaupt nicht Gegenstand einer Vorstellung, geschweige denn einer[Pg 54] Vorstellung als Gesamtkunstwerk sein kann. Vielmehr haben wir es mit einer ganzen Gruppe ihrem Wesen und Kern nach neuer Naturveranschaulichungsmittel zu tun, die einander nebst gewissen Hilfsmitteln alle ergänzen, und eine ohne die andere einfach sinnlos sind. Das wird uns noch mehr klar, wenn wir uns diese neue Welt vorausschauend nicht nach ihrem jetzigen Entwicklungszustande zu vergegenwärtigen suchen, sondern nach der idealen Vollendung, auf die alle vorhandenen Ansätze hinweisen. Dann ist es offenbar, daß zur Kinematographie, wie technisch so auch ästhetisch jene andere Gruppe von Erfindungen gerechnet werden muß: die mechanische Selbstaufzeichnung, Vervielfältigung und Wiedergabe von natürlichen Klangerscheinungen: Ton, Geräusch und Wort, Grammophonie oder Phonographie. Das dem Menschengeist heute vorschwebende, im Kinotheater zum Teil schon verwirklichte Ideal ist (um nun gleich ganz vollständig zu sein): die mechanische Selbstwiedergabe vollständiger Gruppen von Naturerscheinungen, wie wir sie mit Zeichnung, Farbe, Plastik, Bewegung, Klang, Geräusch und vielleicht eines Tages sogar mit Geruchseindrücken mit den Sinnen wahrnehmen. Zwar wird auch eine solche Vorführung niemals menschlich-willkürlicher Erläuterungs- und Ergänzungsmittel, besonders des Wortes, niemals menschlich-künstlicher Durcharbeitung zur Erzielung einer befriedigenden Gesamtwirkung, kurz niemals der „Vermenschlichung“ im Sinne guten Geschmacks entbehren können. Aber in ihrem Wesen wird sie ein neues Werkzeug menschlichen Geistes, eine neue Mehrerin und Wahrerin menschlichen Glückes, Ausbreiterin und Verallgemeinerin menschlichen Wissens, menschlicher Anschauung, menschlicher Kultur, ein Wahrzeichen und Mittel menschlicher Verständigung und Veredlung sein.
Wollen wir aber diese Gesamttechnik — diese Gruppe technischer Künste — im Gegensatz zur Kinematographie im engern Sinne bezeichnen, so müssen wir uns nach einem neuen treffenden Namen umsehen. Er liegt im Worte „Kinematographie“ eigentlich angedeutet. Es besagt „Bewegungs(selbst)niederschrift“, und soll sich eigentlich auf die Festhaltung sichtbarer körperlicher Bewegungen im Bilde beziehen. Wie es aber oft mit solchen Erfindungsbezeichnungen geht, ist auch diese eigentlich schief. Denn Bewegungen im genannten Sinne fängt ja der Kinematograph eigentlich gar nicht auf und gibt sie nicht wieder: er entnimmt ihnen im Gegenteil bewegungslose Augenblicke und hält diese fest. Die Zusammenvorführung dieser Bilder gibt nur den Schein der Bewegung wieder. — Aber eine andere Bewegung hält der kinematographische Film ebenso wie die Photographie überhaupt und auch die Grammophonie fest, und auf dieser „Bewegungsniederschrift“ beruht Wirkung und Wert dieser ganzen Gruppe[Pg 55] von Techniken: ich meine die Bewegung der Licht- und Tonwellen, die von den Gegenständen des Sehens oder des Hörens ausgehen. Diese ununterbrochene Bewegung selber schreibt sich auf chemisch-physikalischem Wege in der Film- wie in der Wachsschicht usw. auf, und sie selber oder doch die Erweckung ihres automatisch genauen Wiederbildes ist die Ursache des auf Papier oder Leinwand wieder sichtbar werdenden Bildes, wie des wiederklingenden Tongefüges. In diesem Sinne haben wir also das Recht, all diese Techniken als auf „Bewegungsselbstaufzeichnung“ beruhend zu bezeichnen. Zum Unterschiede von dem leider schon „verbrauchten“, etwas schief vorweggenommenen Worte „Kinematographie“ — womit ich nach wie vor die Technik des „lebenden Bildes“ meine — habe ich drum vorgeschlagen, die ganze Gruppe mit dem — überdies richtiger oder doch besser gebildeten — Worte „Kinetographie“ zu bezeichnen. Die Silbe „ma“ in diesem Worte ist mindestens überflüssig, es kommt von κινέω, κίνησις (Stamm κιν Verbindung -ετ-). Wenn ich nun von Kinetographie als Vorstellung spreche, so verstehe ich darunter eine solche, die im Kern aus dem Zusammenwirken aller oder mehrerer der genannten Techniken (also auch Lichtbild und später einmal Grammophonie) besteht, die durch Wort, Musik, einstweilen künstlich-mechanische Begleitgeräusche usw. als unentbehrlichen, aber den kinetographischen untergeordneten Bestandteilen gebildet wird.
Aus dem vorigen haben sich schon einige Hinweise auf die äußere Gestaltung eines Programms ergeben. Um aber einem Irrtum vorzubeugen, betone ich nun, daß trotz der Heranziehung aller möglichen Hilfsmittel ein Programm weder seine Einheitlichkeit noch seine Ruhe verlieren, noch ungebührlich lang werden darf. Die erlaubte Länge eines Programms richtet sich allein nach der Aufnahmefähigkeit der Zuschauer, diese aber wieder ganz nach Inhalt und Gliederung des Programms. Je länger es ist, einen desto kunstvollern Aufbau und desto feinere Gliederung erfordert es. Ein Programm mag kurz oder lang sein, es muß in all seinen Teilen eine Steigerung oder doch Wachhaltung und Neubelebung des Interesses bewirken. So wie aber der schönste Ton zuletzt aus Mangel an Atem in Töne zerlegt werden muß, so kann ein langes Programm nicht von einem fortwährenden Sichüberbieten, immer noch heftigern und lebhaftern Eindrücken leben, sondern es muß in Teile zerlegt werden, die jedes in sich selber wieder ein abgeschlossenes Ganze bilden. Aber auch das kürzeste Programm ist verpfuscht, wenn es aus lauter „Schlagern“, aus lauter Bildern[Pg 56] höchster Erregung und Verblüffung besteht. Im Gegenteil. Die Kunst besteht darin, nicht nur „tolle Effekte“, mit denen ja leicht zu wirken ist, unterzubringen, sondern eben auch die feinern und nüchternen Programmbestandteile in Wirkung zu bringen. Das ist ja der größte Fehler fast aller Kinoprogramme, ja der ganzen Kinematographie, daß sie gleichsam aus einem fortwährenden Gebrüll, einem ständigen Sichüberbieten, dem „Totschreien“ aller feinen Wirkungen bestehen. Feine, gute, künstlerische Aufnahmen, die für sich selber und im passenden Rahmen, z. B. einzeln nach dem Vortrag eines Gelehrten angebracht, Stürme von Begeisterung erregen, kommen im Kinotheater gar nicht zur Geltung. Die Beschauer sind durch vorangehende Possen und nachfolgende Schauerdramen in Nervenerregung, sind so starke und grobe Effekte gewohnt, daß sie für die Stimme der schlichten Naturwahrheit, und wär’s in den großartigsten Schauspielen, die die Erde bietet, einfach keinen Sinn haben. Die Mittel, auf denen die Wirkung jedes zeitlichen (Hintereinander-) Kunstwerks, also auch der Kinetographie beruht, sind Steigerung und Gegensätze. Was ich an einem gedachten Meeresfilm skizzierte, das Anheben mit Szenen ruhig schöner Bewegung, die Steigerung nach und nach bis zum Höhepunkte elementarer Erregung, dann das mehr oder minder schnelle Abklingen bis an die Grenze völliger Ruhe — das, mit allen Abwandlungen, muß auch das Gesetz jedes Gesamtprogramms sein. Natürlich kann man’s auch anders machen. Man kann mit einem lustigen „Fortissimo“ einsetzen, mit einem kinematographischen „Galopp“ schließen und dazwischen schwere, langsame Wirkungen verlegen. Man kann auch auf ein „Idyll“ unmittelbar einen „Sturm“ folgen lassen und umgekehrt (wobei ich nicht nur an Idyll und Sturm dem Inhalt sondern auch der Sinnenwirkung nach denke; z. B. auf ein zart gehaltenes Schwarz-Weiß-Lichtbild folgt ein bunter Kinemacolorfilm). Man kann in einen Teil alle ruhigen, mehr belehrenden, oder alle schwarz-weißen Aufnahmen, in einen zweiten alle heitern, bunten oder rein künstlerischen Bilder verlegen usw. Die Hauptsache ist, daß die Programmgestaltung durchdacht ist, und zwar immer nicht „am grünen Tische“, sondern lediglich in Berücksichtigung der lebendigen Wirkung.
Was die Interpunktionszeichen im Aufsatz, das sind die Pausen in einem Programm: Mittel feinster unmittelbarer Kunstwirkung. Es gibt da Kommas, Semikolons, Punkte, Ausrufungs- und Fragezeichen, je nachdem ob es kurze Trennungen zwischen umspringenden Filmteilen oder lange trennende Einlagen sind, ob es allmählich und halb oder plötzlich und ganz hell wird, ob die Pause leer bleibt oder ablenkend ausgefüllt wird usw. Vor allem muß jede Pause[Pg 57] auch wirklich eine sein — ebenso wie jedes Bild eins sein muß. Das heißt (und hiergegen wird sehr viel gesündigt), daß jedes Bild genügend Zeit haben muß, deutlich erkannt zu werden und zu wirken, und jede Pause ausreichen muß, auch wirklich die jeweils bezweckte Ausruhung, Sammlung usw. zu bewirken. Von beiden hängt in erster Linie die Ruhe der Gesamtvorstellung ab, und die ist eine der ersten Bedingungen für ihre künstlerische Vollkommenheit.
Weiter gehört dazu, daß auch die zur gegenseitigen Ergänzung dienlichen Techniken und Hilfsmittel nicht zu ihrer Erdrückung mißbraucht werden. Auch das ist eine der gewöhnlichsten Erscheinungen im Kino. Es ist ein grober Unfug, Bilder von Musik begleiten zu lassen, außer in Ausnahmefällen, wo diese Musik eigens, mit feinstem musikalischen Verständnis und völliger Unterordnung dem Bilde angepaßt und zu seiner Ergänzung oder Erläuterung unentbehrlich ist. Das ist z. B. bei Tänzen der Fall, die ja der Seele entbehren, wenn man die dazu gehörige Musik nicht hört. Noch schlimmer ist die Begleitung der kinematographischen Bilder mit Worten. Der Versuch, ihnen erläuternde „Dialoge“ unterzuschieben, ist ja verständlich, solange schlechte, d. h. für sich unverständliche „dramatische“ Pantomimen das Programm beherrschen. Dann ist eben das Hilfsmittel mehr das in Worte gebrachte „Begleitgeräusch“ (ohne das solche Bilder manchmal unerträglich sind); das unkünstlerische sind die Filme selber. Wovon ich aber spreche, das ist der erläuternde Vortrag. Zum Verständnis gesprochener Worte sind ganz andere Gehirnteile in uns tätig als zur Aufnahme von Bildern durch das Auge. Beide Arbeiten strengen die Nerven an und erfordern unsere ganze Aufmerksamkeit. Auf Erläuterungsworte achten zu müssen, während man gleichzeitig schnell vorbeiwandernde Bilder entziffern soll, das ist daher eine noch größere Qual als diese Zumutung bei Lichtbildern, die wenigstens stillestehen. Eben darum sollte man alle Erläuterungen mit und ohne Hilfe von Lichtbildern (Landkarten, Tabellen, Schemen usw.) unmittelbar vor das Kinobild verlegen, die letzten Sekunden vor diesem aber nur noch, eindringlich und kurz, sprechen. Während des Bildes sollte man sich jeder Störung, selbst des geringsten Hinweises enthalten. Dauert ein Bild länger, und ist es innerlich ohne Steigerung usw. (z. B. eine an sich schöne Fahrt auf schaukelndem Boote durch eine idyllische Landschaft), so mag eine zweite Verwendung von Begleitmusik, nämlich nun zu „melodramatischen“ Zwecken, zur Hebung der Stimmung und Unterstreichung des Rhythmus, gleichzeitig zur Beruhigung der optischen Sinne, in ihr Recht treten. Was von der hier selbstverständlich vorausgesetzten Handmusik gilt, gilt erst recht von der automatischen, soweit diese überhaupt in Betracht kommt. Vielleicht sollte man, um [Pg 58] vereinzelt auf besonders wichtige Vorgänge in Kinobildern aufmerksam machen zu können (da doch manchmal das stoffliche Interesse noch gebieterischer als das stets durch solche Mittel beeinträchtigte ästhetische), kleine Lichtsignale einführen. Es könnten etwa rings um die Leinwand verteilte oder verschiedenfarbige Glühlämpchen sein, die kurz vor überraschend auftretenden, schwierig zu beobachtenden Einzelheiten aufleuchten und während dieser brennen. Durch ihre Lage und Verteilung, auf die vorher aufmerksam gemacht wird, könnten sie auch auf die Stelle der erwarteten Erscheinung hinweisen.
Begleitworte usw. werden um so störender, je mehr wir daran denken, die Gesichtserscheinungen im Bilde auch durch „Begleitgeräusche“ zu ergänzen. Auch diese Geräusche (von denen wir noch sprechen) dürfen aber nur da eintreten, wo sie zum Verständnis oder zur Erhaltung der Phantasie in den richtigen Bahnen unentbehrlich (und natürlich: „richtig“) sind. Sie dürfen weder gewohnheitsmäßig noch aufdringlich werden: nur Begleitung; aber eben auch nicht unwahr zurückhaltend.
Endlich kommt es noch darauf an, den ganzen zur Vorführung nötigen Apparat in einer Weise zu ordnen, daß er den künstlerischen Genuß und Zweck nicht stört, sondern fördert. Da wir immer im Auge behalten, vor allem das kinetographische Wirklichkeitsbild durch sich selber sprechen lassen zu wollen, so ist nötig, alle Hilfsmittel, alles rein technische und besonders das nicht kinetographische, das in Wirklichkeit bei guter Ausführung großen Raum einnimmt, unsichtbar werden zu lassen. Es ist dasjenige, was dem Faden im Puppentheater, der Komparserie auf der Bühne entspricht. Was wir zeigen, sind auf sachgemäß und angenehm ausgestatteter Fläche unsere Bilder, und hin und wieder lassen wir den leitenden Menschenwillen persönlich erscheinen. Wie das alles zu machen ist, erläutert wohl am besten eine Beschreibung der Mustervorstellungen, wie sie seinerzeit der Verfasser mit reichen Hilfskräften und großem Apparat in Dresden und anderswo gab. Sie haben — von einem großen Kreise Gebildeter unterstützt und lediglich dem gemeinnützigen Zwecke dienend, zum erstenmal und bisher nicht wieder erreicht noch nachgeahmt, einer breitern Öffentlichkeit gezeigt, was man mit den damaligen Mitteln (um 1910) erreichen konnte. Ihr Mangel war nun der, daß man sich an die gegebenen Films, wenn auch an die besten der vorhandenen, halten mußte, die aber noch ganz „im alten Stile“ hergestellt waren. Sie sind heute noch ebenso. Wir hoffen durch unsere Schrift dazu beizutragen, daß eines Tages mehr inhaltlich vollendete, formell geschlossene — künstlerisch einwandfreie Bilder zur Verfügung stehen. — Wie wir’s dort machten, läßt es sich in Kinotheatern entsprechend,[Pg 59] vielleicht noch besser, weil weniger kostspielig und durch die Dauer ertragbringender, einrichten.
Eine große und tiefe, erhöhte, gegen das Publikum durch Leinwand und Proszenium abgekleidete Bühne bildete den Schauplatz unserer Taten. Hinter ihr stand der Kinovorführungsapparat, selbstverständlich eine tadellose Präzisionsmaschine, in dem bekannten eisernen, mit Asbest ausgeschlagenen Vorführerhäuschen. Je nach den Verhältnissen war ihm eine Tür geöffnet, oder (am liebsten) nur ein Loch für den Lichtstrahl durch die Wand geschlagen. Wir projizierten also „von hinten“, wodurch die Ablenkung der Neugierde und Aufmerksamkeit durch den den Saal durchschwebenden Lichtstrahl und alle seine Zufälligkeiten vermieden wurde. Auch war nun der Apparat durch Eisengehäuse, Glasfenster, Bühnenwand und Proszenium so isoliert, daß so gut wie gar kein Geräusch mehr hörbar wurde. Die Verständigung mit dem Vorführer wurde anfangs durch verabredete, im Zuhörerraum unhörbare Klingelzeichen bewirkt, später durch Vermittlung von Gehilfen, die den Vortrag hörten und bald die Stellen, wo die Bilder usw. einzusetzen hatten, von selber kannten. Von da an ging alles lautlos, wie durch ein Wunder. Ich bemerke noch, daß wir natürlich Gleichstrom oder Umformer benutzten. Vor und unter dem Kinoapparat stand auf der Bühne der Lichtbilderapparat. Wir hatten drei Vorführer. Zwei — von denen der eine die Verantwortung für den ganzen technischen Apparat, die Bühne, das Personal usw. hatte, also der „technische Leiter“ war — wechselten in der Bedienung des Kinematographen ab, der dritte — ebenfalls gelegentlich von einem andern Mitwirkenden abgelöst — war der Lichtbildermann. Unter diesen „andern Mitwirkenden“ befanden sich stets ein oder zwei Freunde, die mit Vergnügen und Eifer die Geräuschapparate handhabten. Regen zu machen, Wasser rauschen, Züge über Brücken rumpeln, den Sturm heulen, den Donner pumpeln und die Geiser zischen zu lassen, sie ist auch eine Kunst, aber eine dankbare. An der Seite der Bühne saß ferner nicht weniger als ein dreiköpfiges Orchester mit seinen Instrumenten. Klavier, Harmonium, Cello und Geige. Ich wäre unvollständig, wollte ich nicht den schmunzelnden Feuerwehrmann erwähnen, den uns die Polizei nicht aufzunötigen vergaß.
Von diesem kleinen „Wallensteins Lager“ ahnte aber niemand etwas von den edlen Herren und schönen Damen, sowie dem „Volk“ der Großen und der Kleinen, die ehrfurchts- und andachtsvoll, von den pompös betreßten Dienern zwischen polizeivorschriftsmäßig breite, mit den Füßen festgeklemmte Stuhlreihen wandelten, und sich von da aus am Anblick eines prächtigen „Proszeniums“ weideten, oder — wenn’s Kritiker oder „Konkurrenten“ waren — giftige[Pg 60] Bemerkungen austauschten. (Wobei aber festzustellen ist, daß bei weitem die meisten der erstern das, was wir fertig brachten, mit großem Verständnis und warmer Anerkennung empfahlen.) Das, was sie da sahen, war in der Tat so schön, wie’s jemand machen kann, der eben von Vorhandenem auswählen muß. Um die ganze Bühne herum zog sich ein hohes Proszenium aus dunkelrotem, wenig geziertem Plüsch. In der Mitte wies ein leicht angedeuteter Rahmen und ein Samtvorhang von der Farbe des Proszeniums auf die Stelle der lichtdicht abgeschlossen dahinter angebrachten Leinwand hin. Diese Einrichtung hatte nicht nur den Vorzug, geschlossen die Erwartung der Zuschauer auf festliche Geheimnisse zu richten und derweil ihren Augen einen geschmackvollen Ruhepunkt zu geben, (wozu noch vier grüne Lorbeerbäume mitwirkten). Sie lenkte gleichzeitig die Blicke auf die Stelle des eigentlichen Schauspiels, umrahmte diese in schönen Verhältnissen und verhinderte jeden störenden Eindruck ringsum. Sie grenzte einen weiten Raum für die Mitwirkenden ab und verdeckte diese, Instrumente und Apparate, sie dämpfte die Geräusche und fing verirrte Lichtstrahlen und Reflexlichter ab. Seitlich neben dem Vorhang stand, in gleicher Höhe mit der Bildfläche das Rednerpult, von wo der Vortragende frei sprach. Zur Erläuterung an Lichtbildern (Karten usw.) hatte er einen Zeigestock zur Verfügung. Während der Bilder verschwand er ganz im Dunkel. Sein Zu- und Abgang und seine Verbindungen mit der Bühne war, um jede Augenstörung zu vermeiden, durch spanische Wände usw. verdeckt.
Die Vorstellung begann bei hellem Saal mit einem kurzen freien Vortrag. Dieser wendete sich nach kaum merklicher Pause dem ersten Bilde zu und gab eine Beschreibung dessen, was zu erwarten war, in welchem Sinne es aufzufassen, und was darin besonders zu beachten sei. Derweil verdunkelte sich der Saal; die Kohlen in den Apparaten aber glühten zischend auf. Die Vorführer stellten ihre Bilder ein — die Zuschauer merkten nichts von alledem, da der schwere Vorhang die bereits beginnenden Bilder verdeckte. Jetzt ging er auseinander, und der Eisenbahnzug setzte sich durch die Alpenlandschaft hindurch in Bewegung. Dazu ertönte das Rütteln der Wagen, hin und wieder das Pfeifen der Lokomotive. Die Geräusche veränderten ihren Klang, wenn’s über Brücken, durch Tunnel ging. Die Geräusche, anfangs munter und anregend einsetzend, wurden schwächer, nachdem man sie in die Phantasie der Zuschauer eingeführt glauben konnte. Stellenweise wurden sie ganz unterlassen. Trotz gewisser Mängel, die nicht weniger an den (ewig nervös umspringenden) Filmen wie an unserer Unerfahrenheit und der Unzulänglichkeit unserer Maschinen lagen, gewöhnte man sich doch sofort so an sie als an Notwendiges und Selbstverständliches, daß ihr gelegentliches Fortbleiben von ernsthaften [Pg 61] Besuchern peinlich bemerkt wurde. Bevor das Bild „umsprang“, wurde es unsichtbar, und ebenso blieben dem Auge, infolge der geschilderten Einrichtung die unerfreulichen Anfänge des neuen Bildes erspart, es floß gleich fertig aus dem Dunkel hervor. Am Schlusse sprang wieder jene kurze dunkle Pause ein — und an Stelle des Filmbildes stand ein landschaftliches Lichtbild von ruhiger Schönheit da.
Nachdem das lebhafte, von Beifall zeugende und zuerst von Händeklatschen usw. begleitete — Gemurmel sich gelegt hatte, diente nun eine Reihe Lichtbilder der Erläuterung des Vorhergegangenen und der Vorbereitung des Folgenden, zugleich der Augenerholung. Auch die Lichtbilder wechselten so, daß sich zwischen allen die Leinwand einen Augenblick verdunkelte, daher das häßliche Ab- und Anschieben, gelegentlich auch Stocken und Probieren unsichtbar blieb. Dieser Wechsel geschah aber mit der Zeit so prompt, daß wie durch einen Zauber ein Bild an der Stelle des andern stand. Dann wurde es wieder dunkel. Man hörte Wasser rauschen, und als der Zwischenvorhang wieder auseinanderging, sah man einen Wasserfall in Tätigkeit usw. Am Schlusse dieses Teils wurde ein wunderschönes Bild — eins der wenigen auch künstlerisch fast völlig einwandfreien, die es gibt,[1] gespielt. Die Zuschauer wußten erst nicht recht, wo sie waren, als wie ein Zauber zu diesem Bilde eine unsichtbare, zarte und doch in Rhythmus und Melodie wie dazu gemachte (und natürlich angepaßte) Musik dazu erklang, die das Bild bis zu seinem Ausgang begleitete. Der rauschende Beifall, der sich erhob, während sich überm geschlossenen Vorhang der Saal wieder erhellte, galt nicht nur dem ganzen bisher gesehenen, sondern ebenso dem letzten Bilde und dem echten musikalischen Genuß, der damit verbunden gewesen war. Das Proszenium schien eine Sphäre von Zaubergeistern zu sein, ein geheimnisvolles Land von Licht, Leben und Musik.
Auf den ersten Teil folgte ein zweiter, kürzerer. Er bestand aus lauter kurzen (vielfach leider, aber notgedrungen viel zu kurzen) völkerkundlichen Szenen, die im Gegensatz zu den längern und ernstern Landschaften, natürlich besonders munter wirkten. Und hinreißend wirkte es auf jedermann, wenn nun endlich mal die jungen Japanerinnen und nachher die Tiroler nicht zu einer der üblichen Klavierpaukereien, sondern zu einer unsichtbaren, scheinbar von ihren eignen Instrumenten kommenden, nach Möglichkeit „echten“ Musik tanzten! (In diesen Dingen ganz echt zu sein, ist dem Kinotheaterbesitzer leichter, als es uns damals war, wie ich zeigen werde.)
Der dritte Teil war nun derjenige, der die mächtigsten Eindrücke [Pg 62] bringen mußte, sollte er gegen die vorigen nicht abfallen. Daher hatten wir ihm (das Gesamtprogramm hieß: „Schauspiele der Erde“), die „Tausend Spiele des Wassers“ vorbehalten, und ließen es hier nun wirklich am Großartigsten, das die Erde zeigt, nicht fehlen. All unsere Künste mußten sich, nachdem die Rede den gröbsten zu erwartenden Mißverständnissen vorgebeugt hatte, zu kräftiger Wirkung vereinigen, und so rauschten vor unsern Augen die Wasserfälle der „Welt“, donnerten die „Geiser Neuseelands“, brauste die Brandung des Meeres. (Wir hätten auch andere als die „größten“ dieser Schauspiele genommen, wenn sie — zu haben gewesen wären.) Um, worauf es uns ankam, vor allem den sinnlichen Eindruck jener gewaltigen Naturerscheinungen, ihre seelische Wirkung zu erreichen, nahmen wir ganz keck alles, was wir von „Viktoria“-und „Niagara“fällen erreichen konnten, zusammen, und ließen die Wassermassen nur immer stürzen und nebeln, brausen und wirbeln. Dies nach dem Vorurteil gewisser Leute höchst „langweilige“ Schauspiel fesselte ebenso wie die den Schluß bildenden langandauernden Bilder vom Meereswogen alle unsere Zuschauer, selbst kleine Kinder und die einfachsten Leute bis zur Starrheit. Zuletzt, angesichts des beruhigten Meeres, setzte die Melodie von „Das Meer erglänzte weit hinaus“ (Harmonium) ein, und es ging ein Aufatmen aus einem Banne durch die Reihen, als die Vorstellung zu Ende war.
Was wir in dem als Beispiel angeführten Programm „Schauspiele der Erde“ durchzusetzen versuchten, litt unter den Mängeln des uns zur Verfügung stehenden Filmstoffs, zu deren Abhilfe den Weg zu weisen, wir im ersten Teile dieser Schrift versucht hatten. Wir mußten aus bunt zusammengewürfelten, zufällig und meist ohne viel sachliches oder gar künstlerisches Verständnis hergestellten, aus unzähligen unzulänglichen Teilen zusammengeflickten, gar nicht oder unbrauchbar oder gar falsch und irreführend erläuterten Filmen und zufällig auftreibbaren Lichtbildern unser Programm zusammensetzen, ihm danach Namen, Gestalt und Gliederung geben. Wie glücklich werden unsere Nachfolger sein, die einmal den umgekehrten, vernünftigen Weg beschreiten können: sich zuerst eine sachlich begründete, geschlossene Vortragsidee ausarbeiten, danach die richtigen, vollendet hergestellten Filme und Filmteile frei auswählen, wo nicht ihre Herstellung selber bewirken, die geeigneten, an Ort und Stelle gemachten Lichtbilder gleich mit erhalten, die erwähnten ausführlichen Angaben und Beschreibungen, einschließlich Aussprache und Geräuschbeobachtungen usw. fertig vorfinden! Uns hat das alles, obgleich ein kleines Heer von Professoren und gelehrten Fachmännern uns nebst zahlreichen Büchern[Pg 63] unterstützten, eine unendliche und doch schlechterdings nicht völlig zum Ziele führende Arbeit gekostet. Noch heute sind uns einzelne der Filme, die wir damals selber aus London und Paris holten, (im Vertrauen auf die Zuverlässigkeit der Beschreibungen und deren leichte Ergänzung durch Literatur), in Beziehung auf ihren nackten Inhalt ein Buch mit sieben Siegeln geblieben. Eine große Menge Filme haben wir als unerklärbar oder völlig falsch bezeichnet, unbenutzt lassen müssen. Monatelange Arbeit hat uns, unterstützt vom Zufall, zum Verständnis und zur richtigen Bezeichnung gerade der allerschönsten und wertvollsten Bilder verholfen. Dabei ist noch der Schwierigkeit ihrer Erlangung zu gedenken, die bei der auf diesem Gebiete herrschenden Unordnung und den eigentümlichen Interessen der Filmfirmen, in der Tat zuletzt nur durch gefälliges Entgegenkommen ermöglicht wurde. Dies alles war für uns eine gute Schule, deren wertvollste Früchte wir in den vorigen Abschnitten geborgen haben. Eine gute Kinovorstellung wird in der Hauptsache von den Aufnahmeoperateuren und in den Filmateliers gemacht. Ist da gut und richtig Hand in Hand gearbeitet worden, so ist alles weitere für den Vorführungsleiter leicht. Nicht ist im allgemeinen zu erwarten, daß die Bilder zu ganzen abendfüllenden usw. Programmen an einen vorher auszuarbeitenden Vortrag gereiht, zu diesem einzigen Zwecke hergestellt werden. Dazu ist die Kinoaufnahme zu sehr von Zufällen abhängig, und die mannigfache Verwendung und wechselnde Zusammenstellung der Bilder ein zu großer Vorzug. Ich möchte das Erstrebenswerte vielmehr so bezeichnen, daß gleichsam an jeder Kinoaufnahme Verbindungsfäden stehen bleiben, mittels deren sie leicht und passend in jedes Programm hinein verknüpft und wieder daraus gelöst werden kann. Sie muß so gemacht sein, daß sie überallhin paßt. D. h. sie braucht nicht immer für sich selber ein abgeschlossenes, für sich allein den Gegenstand erschöpfendes Ganzes zu sein, aber sie muß den höchsten Anforderungen der Art entsprechen, zu denen sie gehört. Sie muß ferner so erläutert, eingeordnet und zugänglich sein, daß sie für sich selber keine neue Identifizierungs- und Zurichtungsarbeit erfordert.
Solange das nicht der Fall ist, bleibt die Herstellung eines „Musterprogramms“, einer „künstlerisch vollendeten“ Vorstellung eine Gigantenarbeit, und es wird immer noch etwas zu wünschen übrig bleiben. Wir wollen, so gut es geht, die einzelnen Elemente einer solchen Vorstellung sichtend durchgehen.
Noch ehe wir unsere Filme endgültig als Hauptteile in das nach den entwickelten Gesichtspunkten entworfene Gesamtprogramm einfügen, beschäftigt uns die Feststellung ihres Inhalts.[Pg 64] Das ist, wie bemerkt, heute noch eine Arbeit, die oft ans Unmögliche grenzt, in den Kinotheatern usw. aber meist — ganz unbekannt ist. Geboten ist grundsätzliches Mißtrauen gegen die Angaben der beigegebenen gedruckten „Beschreibungen“. Allein die darin enthaltenen Namen sind oft, infolge der fremden Herkunft der meisten Filme, ganz unbrauchbar. Man suche sie an der Hand von Fachwerken, die man in öffentlichen Büchereien findet, in ihrer deutschen Form festzustellen, nötigenfalls fragt man Lehrer und Fachleute. Häufig gelangt man da zu höchst einfachen und bekannten Bezeichnungen allbekannter Dinge, die einem mit ihrem lateinischen, englischen usw. Namen höchst exotisch vorkamen. Sodann verschaffe man sich selbst durch Lesen, Abbildungen usw. ein möglichst genaues und umfangreiches Bild des betreffenden geographischen, naturwissenschaftlichen usw. Gegenstandes. Man wird oft erstaunen, was für ein brennendes Interesse da manche Bilder gewinnen, die man vorher als langweilig ansah. Oft freilich wird man dann auch seinen Film verwerfen müssen, weil er entweder nur Nebensachen des Themas oder auch — etwas ganz anderes zeigt. Nur wenn man selber so etwas von dem Gegenstande kennt, kann man Wert oder Unwert eines Films wenigstens ungefähr beurteilen, und wissen, wo sein Interesse liegt, und in welchem Zusammenhang er unterzubringen ist. Fast alle Filme, belehrende wie unterhaltende, haben „Beziehungen“ zu irgendwelchen Gedankengängen, die Kennern und Gebildeten bekannt sind, beim Anblick der Bilder sofort einfallen und für deren Wert oder Unwert oft entscheidend mitsprechen. Wer diese Beziehungen nicht kennt, tappt im Dunkeln, und kann nie ein Programm zusammenstellen, das geschmackvolle Leute befriedigt. Er suche sich eine Hilfe; auch wenn er ein Universalgelehrter wäre, würde er ohne solche Hilfe nicht auskommen.
Zu den so für würdig befundenen Filmen gilt es nun zunächst, die etwa zum Verständnis unentbehrlichen Lichtbilder herauszufinden. Das ist für den einzelnen schwer, aber solange es die Filmfirmen nicht gleich selber tun, muß man sich an der Hand der Kataloge der Lichtbilderfirmen zu helfen suchen.
Für diesen Zweck wie für den der Filmwahl (für letztere nur unter gewissen, früher erörterten Bedingungen in Betracht kommend) wäre ein von einer Zentralauskunftsstelle anzulegender und zu verwaltender Realkatalog mit Inhalts- und Wertangaben usw. sehr wünschenswert, und auch die Firmen hätten gewiß das größte Interesse daran.
Ich will hier nur darauf aufmerksam machen, daß neben den großen deutschen Firmen wie Unger & Hoffmann in Dresden, Liesegang in Düsseldorf, Vereinen wie der M.Gladbacher und der Berliner [Pg 65] Volksbildungsverein, der Dürerbund usw. auch die Sammlungen des Auslandes in Betracht kommen. Besonders sind die englischen Lichtbilder zum Teil wegen ihres künstlerischen Wertes hervorragend. Zur Belebung und künstlerischen Erhöhung kinetographischer Vorstellungen möchte ich aber besonders auch auf die Verwendung naturfarbiger Einzelaufnahmen (Lumière-Verfahren u. a.) hinweisen. Sie erfordern das hier vorhandene sehr starke Licht, bringen aber das so sehr entbehrte farbige Element in die Vorstellung. Es gibt unter ihnen ebenfalls bereits Kunst und „Kitsch“. Kitsch sind diejenigen Bilder, die um ihrer Buntheit willen gemacht sind. Kunst sind diejenigen, deren Farbenwerte richtig wenigstens angestrebt sind (weder „richtige“ Farben noch „vollkommen richtige“ Farbenwerte sind hier überhaupt möglich, da beides subjektive Begriffe sind) und die eine — soweit sie willkürlich ist — geschmackvolle Farbenzusammenstellung oder Wahl zeigen. Auch hier geht aber oft das stoffliche Interesse mit Recht über das „rein“ ästhetische.
Für die Projektion von Lichtbildern empfiehlt es sich, die häßlichen Bilderwechsel zu verdecken, die Bilder lange genug und ruhig stehen zu lassen und je schöner sie sind, desto weniger durch Reden zu stören, zwischen allen eine genügende Pause zu machen. Die farbigen Lichtbilder sah ich von Courtellemont in Paris sehr wirkungsvoll mit einer Nebelbildereinrichtung (zwei verbundene Cameras) vorgeführt, dergestalt, daß eins durch das neu auftauchende, noch unerkennbare neue verblaßt und unkenntlich wird, unter Rückgang der Helligkeit wechseln beide, und das neue taucht immer heller werdend auf. Freilich waren es prächtige und abwechslungsreiche Bilder, die so vorgeführt wurden.
Auch der Vortrag erhält seinen meisten Stoff aus den zur Inhaltsfeststellung der erwählten Bilder gepflogenen eignen Studien. Hier gilt es nun, in die Tiefe der Erkenntnis, die man sich in aller Eile angeeignet hat, nicht Meter für Meter den Zuhörer hineintauchen, sondern sich hinterher wieder ganz und gar in die Seele jener Unwissenden hineinversetzen, die nur unser Bild sehen werden, und nur das zu seinem Verständnis Nötige wissen wollen. Worte, wenn auch unentbehrlich, sind ein fremder Bestandteil in einer kinetographischen Vorstellung. Wenigstens sind sie hier nicht in ihrer literarischen Kunstanwendung am Platze, sondern nur als kurze, al fresco gegebene eindringliche Erläuterungen. Will man seine Vorstellung mit einem für sich wertvollen Vortrag abwechseln lassen, so setze man ihn eben gänzlich für sich, am besten an den Anfang oder in die Mitte.
So kurz der Vortrag und so wenig und den Nagel auf den Kopf treffend die Worte sein sollen, um so mehr sollte dennoch [Pg 66] und gerade deshalb der Vortragende die Redekunst beherrschen. Er sollte vor allen Dingen völlig über den Schauspieler- wie den Predigerton, über das Deklamieren wie über das Singen hinaus sein. Er soll langsam, deutlich und eindringlich sprechen. Er hat nur kurze Minuten der Aufmerksamkeit vor sich, in ihnen hat er wichtige Gedankenbrücken zu schlagen, Augen zu öffnen, die Geister zu leiten. Er muß darum seine Zeit nutzen. Er muß, solange er spricht, die Aufmerksamkeit voll auf sich lenken, während der Bilder aber völlig untertauchen und alles weiter Nötige mit mechanischen Mitteln zu erzielen suchen.
Sind die Grundzüge von Filmen, Lichtbildern und Vortragsinhalt festgestellt, so kommt die endgültige Ausarbeitung des Programms. Über seine äußere Gliederung und das Spiel von Steigerungen, Ruhepunkten, Abwechslungen, Gegensatzwirkungen haben wir schon gesprochen. In den meisten Kinotheatern ist das Programm ein „rollendes“ — es beginnt für jeden Eintretenden dann, wann er eben kommt. Mindestens wäre es wünschenswert, auch um des ästhetischen Eindrucks willen auf den Ankömmling selbst, die Neueintretenden sich bis zur Beendigung der eben laufenden Szene in einem Vorraum sammeln zu lassen. Im übrigen allerdings wird es für das Programm genug sein müssen, die einzelnen Nummern abwechslungs- oder beziehungsreich aneinanderzureihen und für hübsche Übergänge zu sorgen. Man kann es auch in eine Anzahl kleinere Abteilungen, die ein kleines geschlossenes Ganze bilden, zerlegen. Immer aber läßt sich auch solchem Programm Einheit, nämlich ein einheitlicher Grundgedanke geben. Dieser braucht nicht stets im Stofflichen zu liegen — er kann ganz weit wie ganz eng gefaßt sein. Selbst die Parole „Buntes Allerlei“, nach der einmal alles Erdenkliche zusammengereiht werden kann, kann doch diesen „einheitlichen Grundgedanken“ bilden. Es ist dann mehr eine einheitliche „Stimmung“ oder Stimmungsmischung, die zugrunde liegt. Jedenfalls ist nicht jedes „Bunte Allerlei“ eine künstlerische Einheit, sondern nur eins, dem man anmerkt, daß es Stück für Stück aus einer bestimmten Stimmung oder einem bestimmten Gedankenkreise heraus erwählt ist.
Höher steht, aber auch schwerer zu beschaffen ist ein Programm, das einen einheitlichen Grundinhalt in logischer oder doch sachlicher Folge abhandelt. Da wird man zurzeit noch seine Pläne möglichst allgemein halten müssen. „Der deutsche Wald“, „Englisches Volksleben“, „Von der Spinne“, „Die Töpferei“, „Wie das Brot entsteht“ — so unglaublich es klingt, und auf so viele anklingende Kataloge und Filmtitel der Uneingeweihte mich verweisen wird; man wird kaum die zu irgend einer abgeschlossenen, rein nach dem sachlichen Interesse entworfenen Vorstellung dieser Art die nötigen [Pg 67] guten, richtigen, geschmackvollen, sachlichen, geschweige denn künstlerisch vollendeten Bilder auch nur nennen — und man wird sie noch viel weniger erhalten können! Der Filmmarkt ist zurzeit nur auf die Erfüllung des wöchentlichen Neuigkeitenbedürfnisses der Kinotheater eingerichtet, darüber hinaus versagt seine Organisation völlig. Eher findet sich schon was, wenn man sein Thema faßt: „Vegetationsbilder der Erde“, „Aus dem Leben unterm Mikroskop“, „Von fremden Völkern“ u. dgl. allgemeinen, im Grunde nichtssagenden Titeln. Da findet sich schon was; ob man es kriegt, ist zurzeit Glückssache. Will man ernst zu nehmende Vorstellungen dieser Art zurzeit machen, so ist man schon auf reichliche Zuhilfenahme von Lichtbildern, Vortrag und — Pausen angewiesen.
Wie soll man denn aber zurzeit „künstlerische“ kinetographische Vorstellungen machen? Es gibt nur einen Weg: man besuche, mit dem genügenden Kapital ausgerüstet, die Berliner Filmfirmenvertreter, und passe dort auf die wöchentlich erscheinenden Neuheiten auf. Da hat man wenigstens den Vorteil, die Filme zu sehen. Nun kaufe man auf gut Glück die besten unter ihnen auf und sammle sie an, bis man zu verschiedenen Themen — die man sich unter Berücksichtigung der Gelegenheit zurechtmacht — einigermaßen Stoff beisammen hat. Hierzu kaufe man, indem man sich das Gedächtnis hervorragender Filmkenner und in zweiter Linie die Katalogbeschreibungen der Firmen zunutze macht, ältere gute Filme zur Ergänzung — sehen wird man sie allerdings erst, nachdem man sie bezahlt hat und besitzt. Den so gewonnenen Filmvorrat macht man durch Abtrennung der minderwertigen und mißlungenen, aller zu kurzen, undeutlichen, albernen oder sonst geschmacklosen Abschnitte und durch Umstellung der einzelnen Szenen zurecht, bis die Sache ein Gesicht gewinnt. Man fahnde dazu eifrig nach Lichtbildern und wissenschaftlichem Material usw.— und gehe dann an die Herausgabe der einzelnen Vorstellungen. Wie man schon aus dieser keineswegs pessimistischen Beschreibung sieht, ist das Ganze eine Aufgabe, die für den einzelnen überhaupt geradezu unmöglich ist. Es muß daher ein besonderer Weg zur Verwirklichung gefunden werden — hiervon später.
Die Feststellung der Naturgeräusche ist in vielen Fällen leicht, in den meisten sehr schwer, wenn sie nicht geschmacklos ausfallen sollen; die Ausführung ist meist leicht und wohlfeil. Theaterpraktiker sind darin die besten Ratgeber. Wasserrauschen und Regnen wird oft schon ausgezeichnet durch das Wischen von Papierbüscheln auf der Erde nachgeahmt. Zum Windrauschen läßt man einfach gebaute Kammräder an gespannten Schirtingbahnen schleifen. Erbsen, in einem Sieb geschüttelt, ein großes geschütteltes Blech, eine genial [Pg 68] auf Fell oder Rahmen gehandhabte Trommel für Donner usw., eine Mundpfeife u. dgl. wirken schon Wunder. Wer aber will, kann seine Instrumente mit wenigen Kosten auf noch größere Höhe bringen. Viel schwieriger ist die richtige Beobachtung der Geräusche. Es ist aber doch wohl selbstverständlich, daß ein lautlos fallender Baum, eine lautlos abgeschossene Kanone, ein lautlos aufkochender Geiser nicht nur ein geradezu peinliches Bild geben, sondern auch den Zuschauer, namentlich den unerfahrenen, über die stattfindenden Vorgänge und ihre Kraftverhältnisse völlig irre führen. Ebenso offenbar ist es aber, daß falsch und bloß nach der Phantasie eines gleichfalls unerfahrenen Vorführers gegebene Geräusche nicht minder irreführen und für den Geschmack nicht minder peinlich sind. Das Studium von Naturgeräuschen und ihrer Wiedergabe, an sich ein nicht uninteressanter Zweig der Naturwissenschaften, sollte daher durch die Kinetographie geradezu zu einer Hilfswissenschaft entwickelt werden. Vor allem sollten hier einmal die Grammophonie-Fachmänner einsetzen. Sollte es nicht möglich sein, den unzerlegbaren und doch so reizvollen und bezeichnenden Lärm des Volkslebens in einer Londoner Straße grammophonisch aufzunehmen, während gleichzeitig der Kinematograph den Anblick festhält? Wenn vorläufig beide Aufnahmen noch nicht gleichzeitig aufgenommen werden können, so kann doch beider Zeitmaß mit dem Metronom bestimmt und danach gleichzeitig wiedergegeben werden. Das wäre meines Erachtens das nächste Ziel zur anzustrebenden vollkommenen mechanisch-automatischen Kinematographie. Inzwischen müssen wir uns mit den mehrfach angedeuteten Hilfsmitteln begnügen.
Die Musik! Sie hat ihre Stätte im Kinotheater aus mehrfach genannten Gründen. Gewiß kann sie wegbleiben. Unter allen Umständen ist sie viel mehr einzuschränken, als jetzt im Kinotheater üblich. Auch sie gehört nur dahin, wo sie unentbehrlich ist. Das ist sie vor allen Dingen bei Tänzen und wo irgend im Bilde Musik gemacht wird. Ihre weitere Anwendung ist Geschmackssache. Sie muß der Bildervorführung untergeordnet bleiben, daher ist — wo nicht das Bild selber anderes zeigt — vor allem Streichmusik geeignet. Sie wirkt am feinsten im geschlossenen Raum. Klavier allein ist zu hart und individuell, es drängt sich vor, ist auch zu eintönig. Klavier oder Harmonium zusammen mit Violine und Cello, auch gelegentlich Flöte ist diejenige Zusammenstellung, die sich allen Zwecken am feinsten anpassen läßt und sich am wenigsten vordrängt. Und vor allem nicht vergessen: jede Musik hat einen Sinn! Nicht nur den, den sie dem musikalisch Hörenden unmittelbar ausspricht, den Stimmungsgehalt, sondern gelegentlich oft auch einen recht unerwarteten, durch Textworte festgelegten konventionellen Sinn. Achtung, daß der nicht zum [Pg 69] Bilde wie „die Faust aufs Auge“ paßt! Für Musik gilt ganz besonders die Regel: so wenig wie möglich, aber so vollendet wie möglich und — sinnvoll.
Wohl hauptsächlich aus dem Gefühl der technischen Zusammengehörigkeit heraus, dem auch wir ja schon Ausdruck gaben, findet man besonders in Kinotheatern sehr häufig das Grammophon. Es spielt eine besondere Rolle bei den schon erwähnten „Tonbildern“, die wir mindestens so selten wie möglich im Kinotheater sehen möchten. Wenn diese Art noch nicht vollendet im höchsten technischen Sinne hergestellt werden kann, so sollte wenigstens die künstlerische Wahl und Darstellung einwandfrei sein. Zu gesungenen Liedern einen Mann im Frack hinzustellen, der im Takt dazu die Kinnladen und die Arme bewegt, ist durchaus überflüssig. Der Genuß des Gesanges wird dadurch so wenig wie sein Verständnis gehoben. Anders wär’s, wenn Lieder durch kleine Kostümszenen illustriert würden. Dann aber möchte man diese Szenen wenigstens gut gespielt sehen. Kein „grammophonischer“ Sänger oder Chor sollte sich’s gefallen lassen, daß an seiner Stelle ein Schauspieler dritten oder geringern Ranges mit Maske und Gebärde den Mund auf und zu klappenden Caruso mimt. Da sowohl Kinematographie wie Grammophon noch ihre großen Mängel haben, sollte man sich darauf beschränken, ganz einfache, leichte, mehr im Groben wirkende Stücke festzuhalten, jedenfalls sich nicht an die zartesten oder schwierigsten Meisterwerke der Gesangskunst wagen. Ein von Kinderstimmen gesungenes und schlicht gespieltes Weihnachtslied kann unter Umständen eine niedliche „Tonbild“einlage geben; eine Meisterarie nie.
Will man Grammophon oder Phonographen mitwirken lassen, so ist es geschmackvoller, ihn mit ausgewählten Stücken allein zu Gehör kommen zu lassen. Da aber eine aus unsichtbarem Munde oder vielmehr aus einem Schalltrichter kommende Stimme eine von jedermann peinlich empfundene Unnatürlichkeit darstellt, so hat man von jeher nach einer Maskierung gesucht. Für diese gibt es nur zwei Auswege. Entweder man stellt den Apparat wie er ist, mit einer einfachen, nicht „verzierten“ Trompete weithin sichtbar mitten vor die Zuschauer hin und sagt damit gleichsam: „Jetzt kommt das kinetographische Wunder: der grammophonierte Gesang.“ Das ist am ehrlichsten und ästhetisch einwandfrei. Oder man stellt den Apparat irgendwo hinter der Szene auf, so daß die Klänge gedämpft und wohlberechnet in den Zuhörerraum dringen, wo nichts inzwischen die Aufmerksamkeit ablenkt. Das hat u. a. den Vorteil, Mängel, z. B. die Nebengeräusche, zu verdecken und die Zuhörer nicht abzulenken. Will man mehrere Stücke geben, so vereinige man sie zu [Pg 70] einem Programmteil, zerreiße aber nicht alle Augenblicke durch sie den Zusammenhang der sonstigen Vorstellung.
Für alles andere, besonders die Ausstattung des Bühnenbildes und des Zuschauerraumes gelten die allgemeinen Regeln des guten Geschmacks. D. h.: maßgebend ist vor allem die Zweckmäßigkeit, verboten alles Unehrliche, aller Pomp und Flitter, der etwas anderes vortäuschen soll, als was da ist: eine Stätte gediegener volkstümlicher Unterhaltung. Verboten alles Flimmer- und Zierratenwerk, das die Aufmerksamkeit ablenkt, Auge und Nerven beunruhigt. Nicht die Sinne kitzeln, die Nerven aufregen, die Phantasie erschöpfen, das Denken verwirren soll die Kinetographie. Sondern wenn sie künstlerisch gewesen ist, so erkennt man sie daran, daß man mit erfrischten Sinnen, bereichertem Wissen, gereinigtem Fühlen, klarem Denken und voll deutlicher, erhebender Erinnerungen von ihr nach Hause geht. Das zu erreichen, sei das Ziel aller künstlerischen Kinetographie.
Das zu erreichen, wird sich zwar noch vieles wandeln, mancher gute Kampf wird gekämpft werden müssen. Nicht nur die Kinetographie selbst, sondern unser Gesamtheitsempfinden von dem, was schön und gut ist, wird von Grund auf umgewälzt — oder vielleicht nur vom Alpdruck eines bis zum Wahnsinn überhitzten öffentlichen „Genuß“lebens befreit werden müssen. Mächtige Interessen großer Kreise, die zur Befriedigung ihrer persönlichen Wünsche gewissenlos an den geistigen Kräften der ihnen immer wieder in Scharen als Beute zuwachsenden Jugend schmarotzen, werden unschädlich gemacht werden müssen. Niemals kann die Kinetographie zu künstlerischem Werte gelangen, solange nicht ein Übel unseres heutigen öffentlichen Lebens eingedämmt ist: das Übermaß an ganz oder fast unfreiwilligen geistigen Eindrücken überhaupt, die stündlich auf uns herstürmen. Deren Eindämmung wird wohl am nächsten die Aufgabe der allgemeinen Erziehung, der Aufklärung jedes einzelnen schon von der Schule an sein. Und diese Erziehung und Aufklärung wird an sich kein besseres Mittel benutzen können als den Sinn für das, was wirklich und echt künstlerisch ist, zu stärken. Was wirklich und echt künstlerisch ist, ist auch einfach und selten, sei’s in der Erscheinung, sei’s im Genuß.
Inzwischen aber darf es auch am guten Beispiel, am Bessermachen nicht fehlen. Wie sehr das durch die heutigen Verhältnisse auf dem Gebiete der Kinetographie erschwert ist, habe ich nur andeuten, nicht erschöpfen können. Wenn es sich aber darum handelt, einstweilen das Beste zu tun, was möglich ist, und so die Kräfte zu gewinnen, [Pg 71] allmählich das Vollkommene anzuregen und zu erzwingen, so sei nur dieser Fingerzeig gegeben. Ein einzelner kann wohl künstlerische Musterprogramme schaffen und vorführen, aber er kann sie wirtschaftlich nicht halten. Um das in einem kinetographischen Programm festgelegte Kapital herauszuholen und gar fruchtbar zu machen, muß stets ein Ring (Turnus) von regelmäßigen Verwertern vorhanden sein. Solche Ringe müssen auch die bilden, die die Kinetographie durch Beispiele zur Höhe einer Kunst erheben wollen. Solange eigne Vorstellungen, eigne Theater für den Zweck nicht lohnen, müssen geistig rege Kinotheaterbesitzer zur Einlegung solcher Vorstellungen angeregt werden. Regelmäßige Wochenprogramme dieser Art werden wir ihnen vorläufig noch nicht bieten können, aber vielleicht monatlich eins. Und wir werden erreichen können, daß sie mit diesen Programmen, folgerichtig und streng allen künstlerischen Ansprüchen entsprechend durchgeführt, volle Häuser haben. Volle Häuser aber sind dasjenige, was selbst die Kinowelt mit der Kunst versöhnen wird.
Eines der Haupthindernisse edler Volksbildung ist der Abweg, auf den heute der Kino, dieses an sich so wundervolle Volksbildungsmittel, gekommen ist. Eine Besserung mit allen Kräften zu erkämpfen, ist eine der dringlichsten Aufgaben für jeden, der es mit der sittlichen und künstlerischen Hebung unseres deutschen Volkes ernst meint. Vorzügliche Dienste dabei leistet die im Interesse einer energischen Kinoreform gegründete Zeitschrift „Bild und Film“. Das Abonnement dieser Zeitschrift ist vor allem zu empfehlen den zahlreichen, weitverästelten Volksbildungsorganisationen, der Presse, den Kommunen, Polizeiverwaltungen, Lehrerkreisen, Volks-, Fach-, Fortbildungs- und Hochschulen, den kirchlichen Kreisen der verschiedenen Konfessionen, den verschiedenen Standesorganisationen, die ja alle auch die Volksbildung auf ihre Fahne geschrieben haben: den Arbeitervereinen, Gewerkschaften, Jugendvereinen, Gesellenvereinen, kaufmännischen Vereinen, Beamtenvereinigungen, Frauenorganisationen usw. Ebensosehr aber sind interessiert die Kinobesitzer selbst, denen an der allseitigen Hebung des Kinowesens gelegen ist.
Der I. Jahrgang 1912 von „Bild und Film“ liegt gebunden vor (128 Seiten in gr. 4º), Preis M. 3.20, und ist durch alle Buchhandlungen sowie direkt vom Verlag der Lichtbilderei in M.Gladbach zu beziehen. Der II. Jahrgang läuft von Oktober 1912; monatlich erscheint ein Heft zu 40 Pf., halbjährlich M. 2.40. Das Abonnement kann durch jede Buchhandlung, durch die Post und auch direkt durch den Verlag in M.Gladbach bewirkt werden; im letztern Falle liefert der Verlag im Postüberweisungsverfahren, läßt Bezugsgebühr und Bestellgeld durch die Post einfordern und liefert an diese.
Die von der Zeitschrift „Bild und Film“ vertretenen Reformziele sucht in die Praxis umzusetzen die
Filmverleih-Zentrale der Lichtbilderei GmbH.,
M.Gladbach, Waldhausener Straße 100, Telephon 2095
Über das außerordentlich reiche Lager von Filmen unterrichtet ein gratis zu beziehender „Allgemeiner Katalog“ und ein Spezialkatalog: „Belehrende Filme für Schule und Volk“. Es werden geliefert: Sonntags-, Wochen-, Schüler- und wissenschaftliche Programme, dezent, belehrend und erheiternd für alle Volkskreise zu den billigsten Preisen. Spezial-Offerte gratis und postfrei. Ferner:
Lichtbilder- und kinematographische Apparate sowie
komplette Einrichtungen für Theater.
[1] Fahrt auf dem Avonfluß in Neuseeland, Urbanora Haus, London (s. Katalog der Firma Eclipse, Berlin.)
Anmerkungen zur Transkription:
Der vorliegende Text wurde anhand der 1913 erschienenen Ausgabe nahezu originalgetreu wiedergegeben. Lediglich ganz offensichtlich falsch gesetzte Satzzeichen wurden stillschweigend korrigiert. In heutiger Zeit seltene und unübliche Schreibweisen (z.B. „größern” anstatt „größeren”; „der Kino”) wurden dagegen durchgehend beibehalten.
Insbesondere fremdsprachige Ausdrücke wurden im Original in Antiqua gesetzt, was hier durch reprästentiert wird; Einzelbuchstaben in Aufzählungen und Überschriften sind hiervon aber ausdrücklich ausgenommen.
Gegenüber dem Original wurden die folgenden Korrekturen vorgenommen:
# p. 11: „kinemotographische” → „kinematographische”
# p. 14: „von denn” → „von denen”
# p. 28: „da man sich” → „daß man sich”
# p. 30: „des brandenen” → „des brandenden”
# p. 33: „dieser Zweiges” → „dieses Zweiges”
# p. 36: „wiederspiegeln” → „widerspiegeln”
# p. 40: „nüchterne” → „nüchterner”; „entsprechender” → „entsprechenden”
# p. 42: „Hauptflicht” → „Hauptpflicht”; „lang am” → „langsam”
# p. 47: „Handgeberden” → „Handgebärden”
# p. 53: „zuempfehlen” → „zu empfehlen”
# p. 54: „menschlich-künstlischer” → „menschlich-künstlicher”
# p. 61: „einen unsichtbare” → „eine unsichtbare”
# p. 63: „Ganze” → „Ganzes”
# p. 64: „daß” → „das”
# p. 66: „ales” → „alles”; „diese” → „diesen”